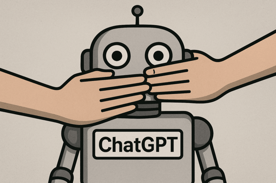Öffentlich-rechtliche Wahrheitswächter: Wenn der Bock zum Gärtner wird
Die ARD hat ein neues Prestigeprojekt aus der Taufe gehoben: Ein "senderübergreifendes Faktencheck-Netzwerk gegen Desinformation". Man könnte meinen, es handle sich um einen verspäteten Aprilscherz, doch die Realität ist ernster. Ausgerechnet jene Medienhäuser, die während der Corona-Zeit jeden kritischen Gedanken als "Schwurbelei" abtaten und deren Glaubwürdigkeit mittlerweile auf dem Niveau von Gebrauchtwagenhändlern rangiert, wollen nun die obersten Wahrheitshüter der Nation spielen.
Das Wahrheitsministerium auf Gebührenbasis
Unter der Federführung des NDR sollen Tagesschau, diverse Landesanstalten, Deutsche Welle und Deutschlandradio ihre Kräfte bündeln. Das Ziel? "Gemeinsame Standards" für faktenbasierte Recherchen etablieren. Man fragt sich unwillkürlich, ob diese Standards auch rückwirkend auf die zahllosen Fehlleistungen der Vergangenheit angewendet werden. Etwa auf die peinliche Potsdam-Affäre, bei der man bereitwillig fragwürdige Correctiv-Inszenierungen übernahm und Behauptungen verbreitete, die Gerichte später als unwahr einstuften?
Die Ironie dieser Initiative könnte kaum beißender sein. Während in den USA Mark Zuckerberg die Reißleine zog und Meta aus der Kooperation mit sogenannten Faktenprüfern ausstieg – weil diese mehr Misstrauen als Vertrauen erzeugten –, marschiert die ARD in die entgegengesetzte Richtung. Mehr Strukturen, mehr Personal, mehr Gebührengeld für ein Instrument, das sich längst als ideologische Keule entpuppt hat.
Wenn Faktenchecks zur Farce werden
Das eigentliche Problem liegt tiefer: Dass man überhaupt spezielle "Faktencheck"-Abteilungen benötigt, offenbart den desolaten Zustand des journalistischen Handwerks in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Fakten prüfen, Quellen vergleichen, Interessenlagen offenlegen – das sollte die Grundlage jeder seriösen Berichterstattung sein, nicht eine Zusatzleistung, die man stolz als Innovation verkauft.
Besonders grotesk wird es, wenn man sich die bisherige Bilanz dieser selbsternannten Wahrheitswächter ansieht. Während der Corona-Zeit wurden kritische Wissenschaftler mundtot gemacht, alternative Behandlungsansätze als gefährlich gebrandmarkt und jede Abweichung vom offiziellen Narrativ als Verschwörungstheorie abgetan. Viele dieser "Verschwörungstheorien" haben sich mittlerweile als diskussionswürdige Positionen oder gar als Tatsachen herausgestellt. Eine Entschuldigung? Fehlanzeige. Stattdessen baut man das System weiter aus.
Der Vertrauensverlust ist messbar
Die Quittung für diese Art von Journalismus zeigt sich in den Reichweiten. Immer weniger Menschen schalten ARD und ZDF ein. Die Zuschauer fühlen sich bevormundet, belehrt und für dumm verkauft. Sie wollen Informationen, keine ideologische Indoktrination. Sie wollen Nachrichten, nicht den erhobenen Zeigefinger einer Redaktion, die ihre eigene politische Agenda als objektive Wahrheit verkauft.
Dabei wäre die Lösung so einfach: Zurück zu den Grundlagen seriösen Journalismus. Alle Seiten zu Wort kommen lassen. Verschiedene Perspektiven beleuchten. Die eigene Fehlbarkeit eingestehen. Doch stattdessen verschanzt man sich hinter einem "Faktencheck-Netzwerk", das in Wahrheit nichts anderes ist als der verzweifelte Versuch, die schwindende Deutungshoheit mit institutioneller Macht zu kompensieren.
Ein Blick über den Atlantik zeigt den Weg
Die Entwicklung in den USA sollte den Verantwortlichen zu denken geben. Dort setzt man mittlerweile auf "Community Notes" – die Nutzer selbst können auf mögliche Falschinformationen hinweisen. Ein demokratischer Ansatz, der auf die Intelligenz und Urteilsfähigkeit der Menschen vertraut, statt sie zu bevormunden. Doch in Deutschland geht man den entgegengesetzten Weg: Mehr Zentralisierung, mehr Kontrolle, mehr von oben herab.
Es ist bezeichnend, dass das ZDF vor Gericht einräumen musste, eigene Nachrecherchen seien im Alltag gar nicht möglich – trotz eines Jahresbudgets von über acht Milliarden Euro für die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt. Wenn man mit solchen Ressourcen nicht einmal grundlegende journalistische Standards einhalten kann, wie will man dann glaubwürdig als Wahrheitsinstanz auftreten?
Die wahre Agenda
Am Ende geht es nicht um Wahrheit, sondern um Macht. Um die Kontrolle über das Narrativ. Um die Deutungshoheit in einer Zeit, in der alternative Medien und soziale Netzwerke das Informationsmonopol längst gebrochen haben. Das neue "Faktencheck-Netzwerk" ist der verzweifelte Versuch, dieses Monopol mit allen Mitteln zu verteidigen.
Doch die Geschichte lehrt uns: Wahrheitsministerien haben noch nie funktioniert. Je mehr eine Institution die absolute Wahrheit für sich beansprucht, desto unglaubwürdiger wird sie. Die Bürger sind nicht dumm. Sie merken, wenn man sie manipulieren will. Und sie wenden sich ab – zu Recht.
Wer wirklich nach Fakten sucht, weiß längst: Die findet man nicht in den "Faktenchecks" von ARD und ZDF. Die findet man durch eigene Recherche, durch das Vergleichen verschiedener Quellen, durch kritisches Hinterfragen – auch und gerade der selbsternannten Wahrheitswächter. In einer Zeit, in der Vertrauen zur härtesten Währung geworden ist, verspielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein letztes Kapital. Das neue "Faktencheck-Netzwerk" ist dabei nicht die Lösung, sondern Teil des Problems.
- Themen:
- #Banken

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik