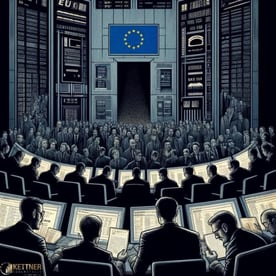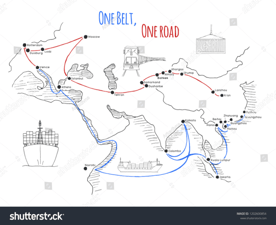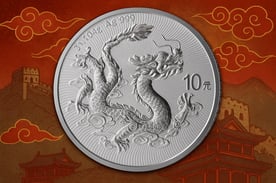
Norwegens Atomkraft-Offensive: Während Deutschland seine Kraftwerke abreißt, bauen die Norweger neue
Es ist schon bemerkenswert, wie unterschiedlich Länder mit ihrer Energiezukunft umgehen. Während in Deutschland funktionstüchtige Kraftwerke wie das hochmoderne Kohlekraftwerk Moorburg in Hamburg abgerissen werden – ein Wahnsinn, der seinesgleichen sucht – planen die Norweger den Einstieg in die Kernenergie. Ausgerechnet die Norweger, die in Energie förmlich schwimmen und deren Fjorde wie gigantische Stauseen funktionieren.
Das Energieparadies plant trotzdem Atomkraft
Man muss sich das einmal vorstellen: Norwegen erzeugt bereits 90 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft. Das Land verfügt über 1.600 Stauseen und ist einer der größten Öl- und Gasexporteure weltweit. Die Einnahmen aus dem Energiegeschäft sprudeln nur so – allein 2024 verdienten die Norweger über 108 Milliarden Euro mehr als bei früheren Durchschnittspreisen. Der staatliche Ölfonds hat mittlerweile einen Wert von sagenhaften 1,6 Billionen Euro erreicht.
Trotz dieses Energiereichtums – oder vielleicht gerade deswegen – denken die Norweger strategisch voraus. Sie planen den Bau eines Small Modular Reactors (SMR) auf Svalbard, einem arktischen Archipel zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol. Ein bleigekühlter Reaktor der vierten Generation soll dort entstehen, mit einer Leistung von etwa 55 Megawatt elektrisch.
Svalbard: Wo selbst die Norweger frieren
Die Wahl des Standorts ist kein Zufall. Svalbard, dessen Hauptstadt den unaussprechlichen Namen Longyearbyen trägt, wurde bis 2023 durch ein Kohlekraftwerk versorgt. Nach dessen Schließung "aus Umweltschutzgründen" – man höre und staune – läuft die Stromversorgung nun über Dieselgeneratoren. Eine teure und unzuverlässige Lösung, selbst für die reichen Norweger.
Der geplante SEALER-Reaktor (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor) soll diese Misere beenden. Es handelt sich um einen schnellen Brüter, der mit flüssigem Blei gekühlt wird – eine Technologie, die inhärent sicher ist und keine aktive Kühlung im Notfall benötigt. Das Projekt wird von einem Joint Venture zwischen Norsk Kjernekraft und dem schwedischen Unternehmen Blykalla vorangetrieben.
Die geopolitische Dimension
Interessant wird es, wenn man die geopolitische Lage betrachtet. Svalbard unterliegt dem Spitzbergenvertrag von 1920, der auch anderen Staaten – darunter Russland – wirtschaftliche Aktivitäten erlaubt. Die Russen betreiben bis heute die Siedlung Barentsburg und haben dort sogar eine Lenin-Statue aufgestellt. In den letzten Jahren kam es wiederholt zu diplomatischen Reibereien zwischen Norwegen und Russland über die Nutzung des Archipels.
Pikant dabei: Die Russen haben bereits vorgemacht, wie man abgelegene arktische Regionen mit Kernenergie versorgt. In Pevek an der Beringstraße liegt seit fünf Jahren das schwimmende Kernkraftwerk "Akademik Lomonossow" mit zwei 40-Megawatt-Reaktoren, das die Region zuverlässig mit Strom und Wärme versorgt. Die Norweger müssen also zugeben: Die Russen haben's erfunden.
Der deutsche Sonderweg ins energiepolitische Abseits
Während Norwegen trotz Energieüberfluss in moderne Kernkrafttechnologie investiert, geht Deutschland den entgegengesetzten Weg. Das Kraftwerk Moorburg in Hamburg – zwei nagelneue 800-Megawatt-Blöcke – wurde nicht als "systemrelevant" eingestuft und kurzerhand abgerissen. Ein Akt der Selbstzerstörung, der in der Wirtschaftsgeschichte seinesgleichen sucht.
Die Hamburger werden künftig ihre Brötchen backen, wenn Wind weht und Sonne scheint. Ansonsten gibt's eben Zwieback mit Salzhering – wie auf den alten Windjammern. Bon Appétit! Währenddessen planen die Norweger, wie sie selbst unter extremsten Bedingungen eine sichere und zuverlässige Energieversorgung gewährleisten können.
Ein Modell für die Zukunft?
Das norwegische Projekt könnte tatsächlich wegweisend sein – nicht nur für abgelegene Regionen, sondern als Blaupause für eine vernünftige Energiepolitik. Small Modular Reactors bieten Vorteile, die in der deutschen Energiedebatte konsequent ignoriert werden: Sie sind sicher, zuverlässig und können auch in extremen Klimazonen betrieben werden.
Während Deutschland seine industrielle Basis durch ideologiegetriebene Energiepolitik gefährdet, zeigen die Norweger, wie man Umweltschutz und Versorgungssicherheit intelligent verbindet. Sie setzen auf Technologie statt auf Wunschdenken, auf Physik statt auf Ideologie.
Es bleibt die bittere Erkenntnis: Ein Land, das in Energie schwimmt, investiert in Kernkraft. Ein Land, das Energie importieren muss, reißt seine Kraftwerke ab. Wenn das nicht die Definition von "dümmster Energiepolitik der Welt" ist – wie das Wall Street Journal die deutsche Energiewende einst nannte – was dann?
- Themen:
- #Energie

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik