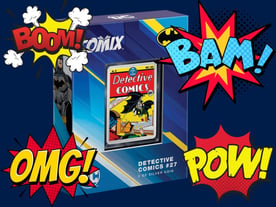Europas Automobilkrise: Wenn grüne Träume auf harte Realitäten prallen
Die neuesten Zahlen des europäischen Herstellerverbands Acea lesen sich wie ein Armutszeugnis für die europäische Klimapolitik. Trotz eines oberflächlichen Anstiegs der Neuzulassungen um 7,4 Prozent im Juli verharrt der Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge weiterhin bei mageren 15,6 Prozent. Die von Brüssel herbeigeträumte Elektromobilitätswende entpuppt sich einmal mehr als Luftschloss, während die Realität eine andere Sprache spricht.
Die Illusion vom grünen Aufschwung
Was auf den ersten Blick wie eine Erholung aussieht, entlarvt sich bei genauerer Betrachtung als statistischer Taschenspielertrick. Der vermeintliche Aufschwung im Juli sei hauptsächlich durch einen Sondereffekt bedingt, wie Branchenexperten einräumen müssen. Händler hätten vor dem Inkrafttreten neuer EU-Regulierungen massenhaft Fahrzeuge zugelassen, die den verschärften Vorschriften nicht mehr entsprächen. Ein verzweifelter Versuch, der bürokratischen Regulierungswut aus Brüssel zu entgehen.
Die Wahrheit ist ernüchternd: Im bisherigen Jahresverlauf sanken die Zulassungszahlen um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch dramatischer wird das Bild im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 – hier liegt der Neuwagenabsatz satte 20 Prozent niedriger. Die europäische Automobilindustrie, einst Stolz und Motor unserer Wirtschaft, kämpft ums Überleben.
Hybride dominieren – Elektroautos bleiben Ladenhüter
Während Politik und Medien unermüdlich die Elektromobilität als Heilsbringer predigen, stimmen die Verbraucher mit ihrem Geldbeutel ab. Hybrid-Modelle dominieren mit einem Marktanteil von 34,7 Prozent klar den Markt. Die Bürger zeigen damit, was sie von der aufgezwungenen Elektrifizierung halten: wenig bis nichts.
Constantin Gall vom Beratungsunternehmen EY bringt es auf den Punkt: Die Nachfrage nach Neuwagen bleibe gering, eine positive Trendwende sei nicht in Sicht. Sowohl Privatkunden als auch Unternehmen hielten sich mit Käufen zurück. Die Gründe lägen auf der Hand: schwaches Wirtschaftswachstum, explodierende Neuwagenpreise und eine allgemeine Verunsicherung durch anhaltende geopolitische Konflikte.
Die Rechnung ohne den Wirt gemacht
Besonders pikant: Staatliche Unterstützungen für den Automobilsektor seien angesichts leerer öffentlicher Kassen "äußerst unwahrscheinlich", so die Einschätzung der Experten. Nach Jahren der Verschwendung für ideologische Prestigeprojekte fehlt nun das Geld für sinnvolle Wirtschaftsförderung. Die Zeche zahlen wie immer die Bürger und die heimische Industrie.
Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hatte versprochen, keine neuen Schulden zu machen. Gleichzeitig wurde ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Infrastruktur aufgelegt und die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz verankert. Diese Widersprüche werden Generationen von Steuerzahlern teuer zu stehen kommen.
Europa verliert den Anschluss
Während China und die USA pragmatisch ihre Automobilindustrie stärken, verstrickt sich Europa in immer neue Regulierungen und ideologische Grabenkämpfe. Die im Juli 2024 in Kraft getretenen neuen EU-Regeln für zusätzliche Assistenzsysteme und eine neue Cybersecurity-Richtlinie sind nur weitere Beispiele für die Überregulierung, die unsere Industrie erdrosselt.
Die Automobilbranche war einst das Aushängeschild deutscher Ingenieurskunst und europäischer Wirtschaftskraft. Heute kämpft sie gegen Bürokratie, unrealistische Klimaziele und eine Politik, die Ideologie über Vernunft stellt. Wenn dieser Kurs nicht korrigiert wird, droht Europa seine industrielle Basis endgültig zu verlieren.
Zeit für einen Kurswechsel
Es braucht dringend eine Rückbesinnung auf marktwirtschaftliche Prinzipien und technologieoffene Lösungen. Statt Verbrenner zu verteufeln und Elektroautos zu subventionieren, sollte der Markt entscheiden, welche Technologie sich durchsetzt. Die Bürger haben bereits abgestimmt – es wird Zeit, dass die Politik diese Entscheidung respektiert.
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen wäre es ratsam, einen Teil des Vermögens in krisensichere Anlagen wie physische Edelmetalle zu investieren. Gold und Silber haben sich über Jahrhunderte als Wertspeicher bewährt und bieten Schutz vor den Folgen verfehlter Politik und wirtschaftlicher Turbulenzen.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik