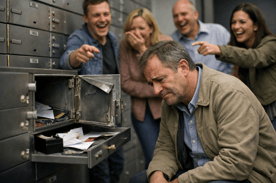EU-Gericht winkt umstrittenes Datenabkommen mit den USA durch – Bürgerrechte erneut auf dem Prüfstand
Das Luxemburger Gericht der Europäischen Union hat gestern ein Urteil gefällt, das Tausende von Unternehmen aufatmen lässt – während Datenschützer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen dürften. Das vor zwei Jahren zwischen der EU und den USA ausgehandelte Datentransferabkommen erhielt grünes Licht, nachdem die beiden Vorgängervereinbarungen vom höchsten europäischen Gericht gekippt worden waren.
Ein fragwürdiger Sieg für die Wirtschaft
Von Banken über Tech-Giganten bis hin zu Pharmaunternehmen und Automobilherstellern – sie alle können nun wieder beruhigt persönliche Daten ihrer europäischen Kunden über den Atlantik schicken. Für Gehaltsabrechnungen, Cloud-Dienste und andere kommerzielle Zwecke sei dies unerlässlich, heißt es aus Wirtschaftskreisen. Doch zu welchem Preis erkaufen wir uns diese vermeintliche Rechtssicherheit?
Der französische Abgeordnete Philippe Latombe hatte gegen das Abkommen geklagt und dabei berechtigte Zweifel geäußert: Die massenhafte Sammlung persönlicher Daten durch US-Geheimdienste stelle eine erhebliche Gefahr für die Privatsphäre europäischer Bürger dar. Seine Kritik am neuen US-Berufungsgremium, an das sich Europäer wenden könnten, traf ins Schwarze – es handle sich keineswegs um ein unabhängiges Tribunal, das den Standards europäischen Rechts genüge.
Richter sehen keine Gefahr – wirklich?
Das Gericht wischte diese Bedenken beiseite und behauptete, die USA würden ein "angemessenes Schutzniveau" für personenbezogene Daten gewährleisten. Die Richter verwiesen auf die angebliche gerichtliche Kontrolle der US-Geheimdienste durch das sogenannte Data Protection Review Court. Doch kann man einem System trauen, das seine eigenen Überwachungspraktiken kontrollieren soll?
"Unter US-Recht unterliegen die Signalaufklärungsaktivitäten der US-Geheimdienste einer nachträglichen gerichtlichen Kontrolle", so die Richter. Eine Formulierung, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet.
Geschichte wiederholt sich – oder doch nicht?
Es ist bereits das dritte Mal, dass Europa und die USA versuchen, ein tragfähiges Datenabkommen zu schmieden. Die beiden Vorgänger – Safe Harbor und Privacy Shield – wurden vom Europäischen Gerichtshof nach Klagen des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems zu Fall gebracht. Schrems äußerte sich auch nach dem aktuellen Urteil skeptisch und deutete an, dass eine umfassendere Prüfung des US-Rechts zu einem anderen Ergebnis führen würde.
Die Timing des Urteils könnte kaum brisanter sein. Während die EU-Kommission Big Tech mit immer schärferen Regulierungen überzieht, droht US-Präsident Donald Trump mit Vergeltungsmaßnahmen. In diesem angespannten transatlantischen Klima wirkt das Urteil wie ein verzweifelter Versuch, die Wogen zu glätten – auf Kosten der Bürgerrechte.
Der Preis der digitalen Abhängigkeit
Was dieses Urteil wirklich offenbart, ist die tiefe Abhängigkeit Europas von amerikanischen Technologiekonzernen und deren Infrastruktur. Statt eigene, souveräne Lösungen zu entwickeln, beugt sich die EU erneut dem Druck der Wirtschaft und opfert dabei die Privatsphäre ihrer Bürger auf dem Altar der wirtschaftlichen Interessen.
Philippe Latombe hat noch die Möglichkeit, beim Europäischen Gerichtshof Berufung einzulegen. Es bleibt zu hoffen, dass die obersten Richter Europas den Mut aufbringen werden, erneut für die Grundrechte der Bürger einzustehen – auch wenn dies bedeutet, sich gegen mächtige Wirtschaftsinteressen zu stellen.
In einer Zeit, in der persönliche Daten zum neuen Gold geworden sind, sollten wir uns fragen: Ist es wirklich klug, diesen Schatz so bereitwillig in die Hände eines Landes zu legen, dessen Geheimdienste für ihre ausufernden Überwachungspraktiken berüchtigt sind? Die Geschichte lehrt uns, dass Vertrauen gut ist – Kontrolle aber besser. Und genau diese Kontrolle geben wir mit diesem Urteil aus der Hand.
- Themen:
- #Banken

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik