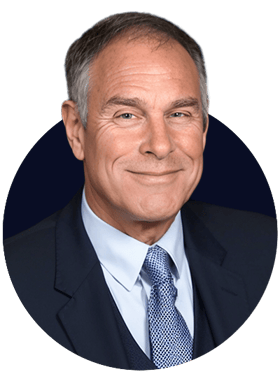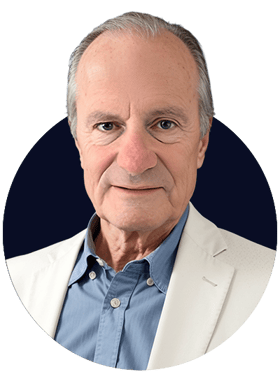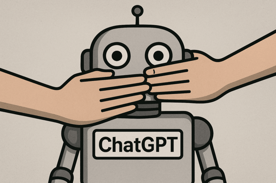Chinas Automarkt-Kollaps: Wenn der sozialistische Traum zum kapitalistischen Albtraum wird
Was passiert, wenn staatliche Planwirtschaft auf freien Markt trifft? China liefert gerade ein Lehrstück darüber, wie man eine ganze Industrie an die Wand fahren kann. Der chinesische Automarkt erlebt derzeit eine Rabattschlacht biblischen Ausmaßes, die selbst hartgesottene Kapitalisten das Fürchten lehrt. Fabrikneue Fahrzeuge landen bei Gebrauchtwagenhändlern – mit einem Drittel Preisnachlass. Ein Phänomen, das es so wohl nur im Reich der Mitte geben könne.
Wenn Neuwagen zu Gebrauchtwagen werden
Der Pekinger Gebrauchtwagenhändler Wang Jianjun präsentiert stolz seinen neuesten Coup: einen fabrikneuen Elektro-Kleinwagen mit null Kilometern auf dem Tacho, der statt der üblichen 12.000 Euro nur 8.000 Euro koste. Seine Erklärung für dieses Paradoxon sei so simpel wie erschreckend: Die kommunistische Führung habe den Markt mit Subventionen geflutet, um ihre ambitionierten E-Auto-Ziele zu erreichen. Das Ergebnis? Über 100 Hersteller produzieren weit mehr, als der Markt verkraften könne.
Diese staatlich befeuerte Überproduktion erinnert fatal an die gescheiterten Fünfjahrespläne vergangener sozialistischer Experimente. Nur dass diesmal nicht Stahl oder Getreide, sondern Elektroautos die Lager verstopfen. Die Ironie der Geschichte: Ausgerechnet China, das sich als Vorreiter der E-Mobilität inszenieren wolle, droht an seinem eigenen Erfolg zu ersticken.
Der Evergrande-Moment der Autoindustrie
Wei Jianjun, Chef des Autokonzerns "Great Wall", wagte es, das Undenkbare auszusprechen: Die Autoindustrie stehe vor ihrem eigenen "Evergrande-Moment". Der Vergleich mit dem spektakulär gescheiterten Immobiliengiganten sei mehr als nur eine rhetorische Warnung. Wie einst im Immobiliensektor habe die Regierung auch hier eine Blase geschaffen, die nun zu platzen drohe.
"Im Moment dauert es etwa sechs bis acht Monate, bevor die Zulieferer bezahlt werden. Die Ausstände in der Branche belaufen sich auf etwa 400 Milliarden Yuan"
50 Milliarden Euro Außenstände – eine Zahl, die selbst für chinesische Verhältnisse schwindelerregend sei. Zulieferer würden zu unfreiwilligen Kreditgebern degradiert, während die Hersteller verzweifelt versuchen würden, ihre Bilanzen zu schönen. Ein Schneeballsystem, das nur so lange funktioniere, wie neue staatliche Gelder nachfließen.
Qualität als erstes Opfer des Preiskampfes
Die Folgen dieser ruinösen Rabattschlacht seien absehbar: Wenn Zulieferer mit Gewinnmargen von gerade einmal zwei Prozent zu Preisnachlässen von zehn Prozent gezwungen würden, bleibe nur ein Ausweg – die Qualität müsse leiden. Ein gefährliches Spiel, besonders bei Fahrzeugen, wo Sicherheit eigentlich oberste Priorität haben sollte.
Die chinesische Regierung versuche nun hektisch gegenzusteuern. Neue Zahlungsfristen von maximal 60 Tagen sollen eingeführt werden. Doch wie so oft bei staatlichen Eingriffen dürfte auch diese Maßnahme zu spät kommen und zu kurz greifen. Der Markt habe längst seine eigene Dynamik entwickelt.
Europa als Rettungsanker – oder nächstes Opfer?
In ihrer Verzweiflung setzen chinesische Hersteller nun verstärkt auf den Export. Europa und insbesondere Deutschland sollen die Überkapazitäten aufnehmen. Trotz EU-Zöllen drängen chinesische E-Kleinwagen für 20.000 Euro auf den deutschen Markt – Fahrzeuge, die in China für läppische 7.000 Euro verschleudert würden.
Diese Dumpingpreise seien keine faire Konkurrenz, sondern das Ergebnis massiver staatlicher Marktverzerrungen. Während deutsche Autobauer sich an strenge Umweltauflagen und soziale Standards halten müssten, würden ihre chinesischen Konkurrenten mit Staatsgeldern gepäppelt. Ein unfairer Wettbewerb, der die europäische Autoindustrie in existenzielle Gefahr bringe.
Die Lehren aus dem chinesischen Desaster
Was können wir aus diesem Debakel lernen? Erstens: Staatliche Eingriffe in den Markt führen unweigerlich zu Fehlallokationen gigantischen Ausmaßes. Zweitens: Subventionen mögen kurzfristig Erfolge bringen, schaffen aber langfristig unhaltbare Abhängigkeiten. Drittens: Am Ende zahlt immer der Steuerzahler die Zeche – sei es in China oder bei uns, wenn wir nicht aufpassen.
Die deutsche Politik täte gut daran, aus Chinas Fehlern zu lernen. Statt eigene Subventionsschlachten zu schlagen, sollten wir auf Innovation, Qualität und faire Wettbewerbsbedingungen setzen. Physische Werte wie Gold und Silber haben sich über Jahrhunderte als krisenfeste Anlage bewährt – im Gegensatz zu staatlich aufgeblähten Industrieblasen, die irgendwann platzen müssen.
Der chinesische Automarkt zeige eindrucksvoll, wohin es führe, wenn Politik glaubt, besser als der Markt zu wissen, was gut für die Wirtschaft sei. Ein mahnendes Beispiel, das auch unsere Ampel-Nachfolger ernst nehmen sollten, bevor sie mit ähnlichen Experimenten die deutsche Wirtschaft ruinieren.
- Themen:
- #Übernahmen-Fussion
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
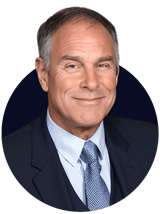
Rick Rule
Rohstoff-Legende
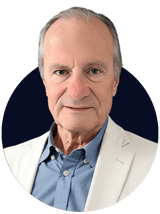
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik