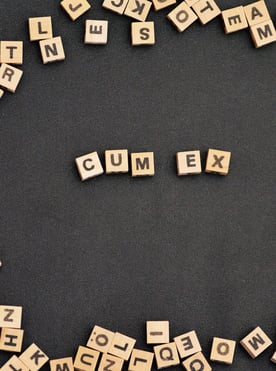
Trump triumphiert: Zölle zeigen keine Inflationswirkung – Goldman Sachs in der Kritik
Die Propheten des wirtschaftlichen Untergangs müssen sich warm anziehen. Während die Mainstream-Medien und Wall-Street-Analysten monatelang vor einer drohenden Inflationswelle durch Trumps Zollpolitik warnten, zeigen die harten Fakten ein völlig anderes Bild. Der US-Präsident ließ seiner Frustration über die Fehlprognosen freien Lauf und nahm dabei besonders Goldman Sachs ins Visier.
Billionen für die Staatskasse statt Inflation für die Bürger
„Billionen von Dollar fließen durch Zölle ein, was unglaublich für unser Land, seinen Aktienmarkt, seinen allgemeinen Wohlstand und so ziemlich alles andere war", polterte Trump in einem seiner charakteristischen Social-Media-Beiträge. Die Realität gibt ihm recht: Trotz aller Unkenrufe haben die Zölle weder zu Inflation noch zu anderen wirtschaftlichen Problemen geführt. Stattdessen sprudeln die Steuereinnahmen wie selten zuvor.
Besonders pikant: Die Verbraucher zahlen die Zeche größtenteils gar nicht. Es seien hauptsächlich Unternehmen und ausländische Regierungen, die die Kosten tragen würden, so Trump. Eine Aussage, die den Narrativ der Zoll-Kritiker fundamental erschüttert.
Goldman Sachs-CEO im Kreuzfeuer
Mit beißendem Spott überzog Trump Goldman Sachs-Chef David Solomon: „Ich denke, David sollte sich einen neuen Ökonomen suchen oder vielleicht sollte er sich einfach darauf konzentrieren, DJ zu sein, anstatt sich damit zu beschäftigen, ein großes Finanzinstitut zu führen." Ein Seitenhieb auf Solomons Nebentätigkeit als DJ, der in Wall-Street-Kreisen für Gesprächsstoff sorgen dürfte.
„Sie machten vor langer Zeit eine schlechte Vorhersage sowohl über die Marktauswirkungen als auch über die Zölle selbst, und sie lagen falsch, genau wie sie bei so vielem anderen falsch liegen."
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache
Die jüngsten Inflationsdaten bestätigen Trumps Position eindrucksvoll. Der Verbraucherpreisindex stieg im Juli um moderate 0,2 Prozent im Monatsvergleich und liegt mit 2,7 Prozent im Jahresvergleich sogar unter den Erwartungen. Die Kerninflation bewegte sich mit 3,1 Prozent zwar leicht über den Prognosen, doch von einer zollbedingten Preisexplosion kann keine Rede sein.
Besonders aufschlussreich ist die Analyse der einzelnen Preistreiber: Flugpreise, Zahnbehandlungen, Kfz-Versicherungen und Mieten – allesamt Bereiche, die mit Zöllen rein gar nichts zu tun haben – trieben die Inflation. Währenddessen blieben typische Importgüter wie Neuwagen, Bekleidung und Spielwaren praktisch unverändert.
Goldman Sachs rudert zurück
Ironischerweise musste selbst Goldman Sachs in jüngsten Analysen einräumen, dass ausländische Exporteure einen erheblichen Teil der Zollkosten absorbieren. Die Bank prognostiziert zwar weiterhin steigende Verbraucherbelastungen bis Jahresende, doch ihre bisherigen Vorhersagen erwiesen sich als maßlos übertrieben.
Jan Hatzius, Chefökonom bei Goldman, behauptete kürzlich, US-Firmen würden bis zu zwei Drittel der erhöhten Zollkosten tragen. Eine Behauptung, die sich in den Quartalsergebnissen der Unternehmen allerdings nicht widerspiegelt.
Die wahren Inflationstreiber
Während die Zoll-Hysterie in sich zusammenfällt, zeigen die Daten die tatsächlichen Problemfelder auf. Der sogenannte „SuperCore"-Index, der Dienstleistungen ohne Wohnkosten misst, stieg mit 0,55 Prozent im Monatsvergleich auf den höchsten Stand seit Januar. Transportkosten und medizinische Dienstleistungen – beides Bereiche ohne Zolleinfluss – treiben die Preise nach oben.
Die Güterinflation beschleunigt sich zwar leicht, doch Experten führen dies eher auf Energiekosten als auf Zölle zurück. Joseph Lavorgna, ehemaliger Chefökonom des National Economic Council, bringt es auf den Punkt: „Der jüngste Inflationsbericht zeigt weiterhin keine negativen Auswirkungen der Zölle."
Lehren für Deutschland
Während Trump mit seiner protektionistischen Politik Erfolge feiert und die Staatskassen füllt, sollte dies auch hierzulande zum Nachdenken anregen. Die deutsche Politik, die sich oft in ideologischen Grabenkämpfen verliert, könnte von diesem pragmatischen Ansatz lernen. Statt sich in Klimaneutralitäts-Fantasien zu verstricken und mit einem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen künftige Generationen zu belasten, wäre eine Politik, die nationale Interessen in den Vordergrund stellt, durchaus überlegenswert.
Die Tatsache, dass ausländische Unternehmen und Regierungen einen Großteil der Zollkosten tragen, während die heimische Wirtschaft profitiert, widerlegt die Freihandels-Dogmen der Globalisten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass auch Deutschland seine wirtschaftspolitischen Prioritäten überdenkt.
Die Wall Street mag über Trumps rustikale Art die Nase rümpfen, doch die Zahlen geben ihm recht. Während die selbsternannten Experten mit ihren Untergangsszenarien danebenlagen, füllen sich die amerikanischen Staatskassen. Eine Lektion, die auch für die deutsche Politik lehrreich sein könnte – wenn sie denn bereit wäre, ideologische Scheuklappen abzulegen.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik












