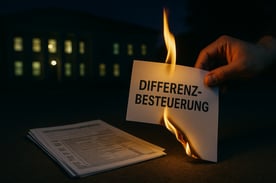Milliardenschwerer Steuerraub: Wie die Politik beim Cum-Cum-Betrug wegschaut
Während die Ampel-Regierung den Bürgern immer neue Steuern aufbürdet und von "Solidarität" schwadroniert, plündern Banken und Investoren weiterhin ungeniert die Staatskasse. Der Cum-Cum-Skandal, der Deutschland bereits 29 Milliarden Euro gekostet haben soll, geht munter weiter – und die Politik schaut tatenlos zu. Ein Lehrstück über die unheilvolle Allianz zwischen Finanzlobby und Regierung.
Das Ausmaß des Skandals sprengt jede Vorstellungskraft
Die Zahlen sind schwindelerregend: Allein zwischen 2000 und 2020 soll der deutsche Staat durch Cum-Cum-Geschäfte knapp 29 Milliarden Euro verloren haben, schätzen Experten der Universität Mannheim. Weltweit belaufe sich der Schaden auf über 140 Milliarden Euro. Geld, das in Schulen, Straßen oder die Sicherheit unserer Bürger hätte fließen können. Stattdessen landet es in den Taschen cleverer Finanzjongleure, die das System schamlos ausnutzen.
Das Perfide daran: Obwohl die Machenschaften längst bekannt sind und unter bestimmten Umständen sogar illegal, läuft das große Plündern weiter. Anne Brorhilker, ehemalige Oberstaatsanwältin und heute bei der Organisation "Finanzwende" tätig, bringt es auf den Punkt: Die Behörden wüssten sehr wohl Bescheid, behaupteten aber gerne das Gegenteil mit der Standardfloskel "Uns ist das nicht bekannt".
So funktioniert der legalisierte Raubzug
Das Prinzip der Cum-Cum-Geschäfte ist so simpel wie dreist: Ausländische Finanzinstitute verleihen ihre deutschen Aktien kurz vor der Dividendenausschüttung an deutsche Partner. Diese lassen sich die Kapitalertragssteuer erstatten – ein Privileg, das eigentlich nur inländischen Anlegern zusteht. Nach der Transaktion wandern die Aktien zurück, der Gewinn wird geteilt. Ein Taschenspielertrick auf Kosten der Allgemeinheit.
Christoph Spengel von der Universität Mannheim erklärt, dass eine simple Gesetzesänderung genügen würde: Die Besteuerung der Wertpapierleihgebühren. In Ländern, die dies bereits umgesetzt hätten, existierten keine Cum-Cum-Geschäfte. Doch in Deutschland? Fehlanzeige. Bereits 2016 mahnte Spengel vergeblich. Die Politik hatte offenbar Wichtigeres zu tun – oder kein Interesse daran, ihren Gönnern aus der Finanzbranche das Handwerk zu legen.
Behördenversagen als System
Die Gründe für das fortgesetzte Versagen sind vielfältig und erschreckend zugleich. Brorhilker zeichnet das Bild einer Verwaltung, die dem organisierten Finanzbetrug hoffnungslos unterlegen ist. Chronische Unterbesetzung bei den Betriebsprüfungen, veraltete Technik, mangelnde Abstimmung zwischen den Behörden – die Liste des Versagens ist lang.
"Das einzige Risiko ist das Risiko, durch die Behörden entdeckt zu werden. Dieses Risiko ist solange sehr gering, solange die Behörden so schlecht aufgestellt sind"
Besonders grotesk: Während die Finanzbranche mit modernster Technik operiert, scheitern deutsche Behörden schon am Versenden verschlüsselter E-Mails. Ein Rotationsprinzip sorgt dafür, dass Fachwissen verloren geht, bevor es überhaupt aufgebaut werden kann. Man könnte meinen, das System sei bewusst so konzipiert, um Steuerhinterziehung zu erleichtern.
Die Macht der Finanzlobby
Fast 40 Millionen Euro jährlich investiert die Finanzbranche in Lobbyarbeit – mehr als Auto- und Chemieindustrie zusammen. Mit 442 Lobbyisten kommen rechnerisch fast zehn Interessenvertreter auf jedes Mitglied des Finanzausschusses im Bundestag. Diese geballte Macht zeigt Wirkung: Verschärfungen werden verhindert, Schlupflöcher bleiben offen.
Monika Heinold, ehemalige Finanzministerin Schleswig-Holsteins, berichtet aus eigener Erfahrung, wie Lobbyisten versuchten, Steuergesetze zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Leider fänden sie "viel zu oft Gehör". Mehrere Abgeordnete des Finanzausschusses bezögen sogar Nebeneinkünfte von Sparkassen oder Volksbanken – ein Interessenkonflikt, der offenbar niemanden stört.
Die neue Regierung macht es nicht besser
Auch unter der neuen Großen Koalition von CDU/CSU und SPD zeichnet sich keine Besserung ab. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) kündigte zwar an, die Aufbewahrungsfristen für Belege im Cum-Cum-Skandal zu verlängern. Doch das ist bestenfalls Symbolpolitik. Die eigentlichen Gesetzeslücken bleiben weiterhin sperrangelweit offen.
Besonders pikant: Das 2024 beschlossene Bürokratieabbaugesetz mit seinen verkürzten Aufbewahrungsfristen könnte der Finanzbranche sogar helfen, ihre illegalen Geschäfte noch besser zu verschleiern. Man fragt sich unwillkürlich: Wessen Interessen vertritt diese Regierung eigentlich?
Ein Staat, der sich selbst aufgibt
Der Cum-Cum-Skandal ist mehr als nur ein Finanzskandal. Er ist ein Symptom für einen Staat, der seine ureigenen Aufgaben nicht mehr wahrnimmt. Während hart arbeitende Bürger mit immer neuen Steuern und Abgaben belastet werden, lässt man Finanzjongleure gewähren, die sich schamlos am Gemeinwohl bereichern.
Die 29 Milliarden Euro, die Deutschland durch Cum-Cum-Geschäfte verloren hat, fehlen an allen Ecken und Enden. Sie fehlen bei der Polizei, die unsere Straßen nicht mehr sicher machen kann. Sie fehlen in den Schulen, wo der Putz von den Wänden bröckelt. Sie fehlen bei der Infrastruktur, die zusehends verfällt. Stattdessen finanzieren sie die Boni von Bankern, die sich über die Dummheit der Politik kaputtlachen.
Es ist höchste Zeit, dass die Bürger aufwachen und Politiker wählen, die wieder für Deutschland und nicht für die Finanzlobby arbeiten. Die Gesetzeslücken müssen geschlossen, die Behörden ordentlich ausgestattet und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Nur so lässt sich das Vertrauen in unseren Rechtsstaat wiederherstellen. Denn eines ist klar: Ein Staat, der sich von Finanzhaien ausplündern lässt, hat seine Daseinsberechtigung verloren.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik