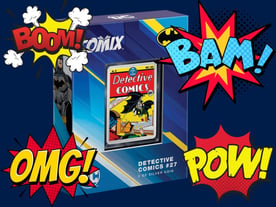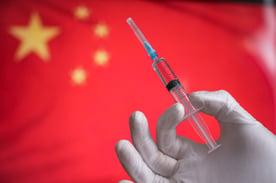
Faber-Castell verrät deutsche Arbeiter: Traditionswerk wandert nach Peru aus
Ein weiteres Kapitel deutscher Deindustrialisierung wird geschrieben: Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell schließt sein Werk in Engelhartszell an der Donau. Nach über 60 Jahren endet damit ein Stück oberösterreichischer Industriegeschichte. Die Produktion von Textmarkern wandert ins ferne Peru ab – 41 Familien stehen vor dem Nichts. Was für ein verheerendes Signal in Zeiten, in denen Europa ohnehin mit massiver Abwanderung kämpft.
Der Verrat kam über Nacht
Noch vor zwei Jahren feierte man in Engelhartszell das 60-jährige Werksjubiläum. Die Gemeinde verkaufte sogar Grundstücke für eine geplante Erweiterung, eine Photovoltaikanlage wurde installiert – alles schien auf Wachstum ausgerichtet. Doch während die Arbeiter noch an die Zukunft glaubten, plante die Konzernführung bereits den Exodus. Ein Defizit von zwei Millionen Euro reichte aus, um sechs Jahrzehnte Treue und Tradition über Bord zu werfen.
Die Begründung des Konzerns liest sich wie aus dem Lehrbuch neoliberaler Globalisierung: Internationale Effizienz, Kostensenkung, Wettbewerbsvorteile. Was man zwischen den Zeilen liest: Deutsche und österreichische Arbeiter sind zu teuer geworden. In Peru lässt sich billiger produzieren – auf dem Rücken von Menschen, die für einen Bruchteil des Lohns schuften.
Die wahren Gründe hinter der Flucht
Natürlich schiebt Faber-Castell die Schuld auf äußere Umstände: US-Zölle, globale Handelskonflikte, gestiegene Materialpreise. Doch die Wahrheit dürfte komplexer sein. In einer Zeit, in der die Energiepreise in Europa durch eine verfehlte Klimapolitik explodieren und die Bürokratie jeden unternehmerischen Spielraum erstickt, suchen Konzerne ihr Heil in der Flucht.
„Über Generationen hinweg prägte die Fabrik das Ortsbild. Nun verliert Engelhartszell ein Stück Identität und wirtschaftliche Perspektive."
Diese Worte eines Gemeindevertreters bringen es auf den Punkt. Es geht nicht nur um 41 Arbeitsplätze – es geht um das Ausbluten ganzer Regionen. Während in Berlin und Brüssel über Gendersternchen und CO2-Neutralität debattiert wird, stirbt die industrielle Basis Europas einen langsamen Tod.
Peru profitiert von Europas Schwäche
Die Verlagerung nach Lima ist symptomatisch für einen größeren Trend. Südamerika lockt mit niedrigen Löhnen, laxeren Umweltauflagen und Zollvorteilen. Was in Europa als soziale Errungenschaft gilt – faire Löhne, Arbeitnehmerschutz, Umweltstandards – wird zum Standortnachteil im globalen Wettbewerb. Die bittere Ironie: Dieselben Politiker, die diese Standards hochhalten, wundern sich dann über Arbeitslosigkeit und Strukturschwäche.
Ein Musterbeispiel gescheiterter Politik
Der Fall Faber-Castell zeigt exemplarisch, wohin uns die Politik der letzten Jahre geführt hat. Während man in Deutschland Atomkraftwerke abschaltet und die Energiewende zur Religion erhebt, wandern energieintensive Betriebe ab. Die Rechnung zahlen nicht die Politiker in ihren klimatisierten Büros, sondern die Arbeiter in Engelhartszell.
Besonders perfide: Noch läuft die Produktion bis Sommer 2026 weiter. Die Mitarbeiter sollen also noch anderthalb Jahre lang für ihren eigenen Untergang arbeiten, bevor die Maschinen endgültig verstummen. Für ältere Arbeitnehmer bedeutet das faktisch das Ende ihrer beruflichen Laufbahn – in einer Region, in der alternative Arbeitsplätze Mangelware sind.
Die Globalisierung frisst ihre Kinder
Was bleibt, ist Ernüchterung. Der offene Brief des Bürgermeisters an die Eigentümerfamilie von Faber-Castell wird wohl ungehört verhallen. In der schönen neuen Welt der Konzernstrategen zählen nur noch Quartalszahlen und Renditen. Tradition, Verantwortung, regionale Verbundenheit – alles Relikte einer vergangenen Zeit.
Die Schließung in Engelhartszell könnte nur der Anfang sein. Faber-Castell hat bereits angekündigt, weitere Standorte auf den Prüfstand zu stellen. Die Botschaft ist klar: Wer in Europa produziert, lebt gefährlich. Die Zukunft gehört denjenigen, die rechtzeitig die Flucht ergreifen – nach Peru, Vietnam oder sonst wohin, wo Arbeiter noch für Hungerlöhne schuften.
Zeit für eine Kehrtwende
Es wird höchste Zeit, dass die Politik aufwacht. Statt immer neue Belastungen für die heimische Wirtschaft zu erfinden, brauchen wir eine Renaissance der Industriepolitik. Niedrigere Energiekosten, weniger Bürokratie, mehr Pragmatismus – nur so lässt sich der Exodus stoppen. Andernfalls werden wir noch viele Engelhartszells erleben.
Die 41 Arbeiter in Oberösterreich sind nur die jüngsten Opfer einer verfehlten Politik. Ihre Schicksale sollten uns eine Warnung sein: Wer seine industrielle Basis aufgibt, verliert nicht nur Arbeitsplätze, sondern seine Zukunft. In Zeiten globaler Unsicherheit rächt sich die Naivität, mit der Europa seine Stärken preisgegeben hat. Gold und Silber mögen als Wertanlage Sicherheit bieten – doch was nützt das, wenn die Grundlagen unseres Wohlstands verschwinden?
- Themen:
- #Energie

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik