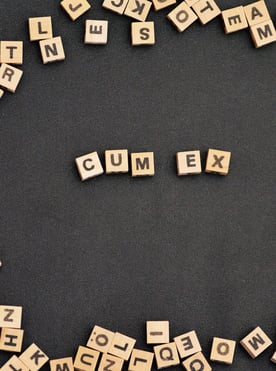
Autogipfel im Kanzleramt: Merz kämpft um Deutschlands Automobilzukunft – doch wer zahlt die Zeche?
Die deutsche Automobilindustrie steht am Scheideweg, und Bundeskanzler Friedrich Merz hat für den 9. Oktober einen Krisengipfel im Kanzleramt einberufen. Während die Konzernchefs von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen ihre Forderungskataloge vorbereiten, stellt sich die entscheidende Frage: Sollen die deutschen Steuerzahler erneut Milliarden für eine Technologie aufbringen, deren Erfolg mehr als fraglich erscheint?
Die unbequeme Wahrheit über Deutschlands Autokrise
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Gewinne der deutschen Autobauer schrumpfen dramatisch, die Kostenstrukturen passen nicht mehr zur wirtschaftlichen Realität, und die Transformation zur Elektromobilität erweist sich als kostspieliges Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Besonders brisant: Die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos könnte ab 2026 wegfallen – ein Schritt, der längst überfällig wäre.
Merz betonte kürzlich sein Vorhaben, das EU-weite Verbrennerverbot ab 2035 zu kippen. Ein vernünftiger Ansatz, denn während deutsche Hersteller auf politischen Druck hin Milliarden in die Elektromobilität pumpen, verdienen sie ihr Geld weiterhin mit bewährten Verbrennungsmotoren. Die ideologiegetriebene Verbotspolitik der vergangenen Jahre rächt sich nun bitter.
Subventionswahnsinn ohne Ende?
Die Forderungen der Automobillobby sind vorhersehbar: Mehr Steuergelder, mehr Förderungen, mehr staatliche Unterstützung. VDA-Präsidentin Hildegard Müller warnt vor "erheblichen Folgen" für die E-Mobilität, sollte die Steuerbefreiung wegfallen. Doch diese Drohkulisse verfängt nicht mehr. Die deutsche Bevölkerung hat genug von einer Politik, die Milliarden in Technologien pumpt, während gleichzeitig die Infrastruktur verfällt und die Sozialsysteme unter Druck geraten.
"Der Automobildialog muss zu klaren Vereinbarungen führen, was der Staat an Rahmenbedingungen leisten kann", fordert SPD-Wirtschaftspolitiker Sebastian Roloff.
Was der Staat leisten kann? Die Frage sollte vielmehr lauten: Was sollte der Staat überhaupt leisten müssen? Die Automobilindustrie hat jahrzehntelang Rekordgewinne eingefahren. Nun, da die selbstverschuldete Transformation stockt, soll der Steuerzahler einspringen?
Die soziale Schieflage der E-Auto-Förderung
Besonders perfide ist die soziale Dimension dieser Debatte. Während gut verdienende Dienstwagenfahrer von massiven Steuerprivilegien profitieren – mehrere Milliarden Euro jährlich –, können sich normale Arbeitnehmer die teuren Elektrofahrzeuge nicht leisten. Das im Koalitionsvertrag versprochene "Social Leasing" für einkommensschwächere Menschen? Fehlanzeige. Die Große Koalition bedient lieber ihre Klientel als sich um die Bedürfnisse der breiten Bevölkerung zu kümmern.
Thomas Peckruhn vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe spricht von einem "Schlag ins Kontor" für den Autohandel, sollte die Steuerbefreiung wegfallen. Doch warum sollte eine Technologie, die sich angeblich durchsetzen wird, dauerhaft am Subventionstropf hängen? Wenn Elektroautos wirklich die Zukunft sind, müssten sie sich auch ohne staatliche Krücken am Markt behaupten können.
Der internationale Wettbewerb als Realitätscheck
Während deutsche Hersteller auf politischen Druck hin ihre bewährten Geschäftsmodelle über Bord werfen, drängen asiatische Anbieter mit günstigen und technisch ausgereiften Fahrzeugen auf den Markt. Diese Konkurrenten haben eines verstanden: Der Markt entscheidet über Erfolg und Misserfolg, nicht die Politik. Die deutschen Konzerne hingegen haben sich in eine fatale Abhängigkeit von staatlichen Förderungen begeben.
Zeit für einen Kurswechsel
Der Autogipfel bietet Merz die Chance, einen überfälligen Kurswechsel einzuleiten. Statt weitere Milliarden in eine fragwürdige Technologieförderung zu pumpen, sollte die Regierung endlich auf Technologieoffenheit setzen. Das bedeutet: Schluss mit ideologischen Verboten, Schluss mit einseitiger Förderung, Schluss mit der Bevormundung mündiger Bürger.
Die Automobilindustrie muss lernen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Innovationen entstehen durch Wettbewerb, nicht durch Subventionen. Und die deutschen Steuerzahler haben ein Recht darauf, dass ihr Geld sinnvoll eingesetzt wird – nicht für die Rettung von Geschäftsmodellen, die ohne staatliche Hilfe nicht überlebensfähig sind.
Die Entscheidung über die Zukunft der Kfz-Steuerbefreiung wird zum Lackmustest für die neue Regierung. Wird sie den Mut haben, unpopuläre aber notwendige Entscheidungen zu treffen? Oder wird sie dem Druck der Lobbyisten nachgeben und weiter Geld in ein Fass ohne Boden werfen? Die deutsche Bevölkerung hat genug von einer Politik, die Partikularinteressen über das Gemeinwohl stellt. Es ist Zeit für einen echten Neuanfang – auch und gerade in der Automobilpolitik.
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik















