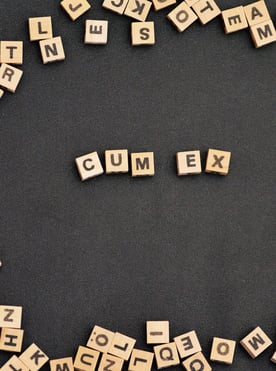
Trumps Zoll-Keule: Die Schweiz zahlt den Preis für ihre Unterwürfigkeit
Die Schweiz hat sich einmal mehr zum Spielball fremder Mächte degradieren lassen. Während Donald Trump mit seinem Zollhammer zuschlägt und satte 39 Prozent auf Schweizer Exporte erhebt, kuscht Bern wie ein geprügelter Hund. Die bittere Wahrheit: Wer sich einmal erpressen lässt, wird zur ewigen Melkkuh. Ein Prinzip, das jedes Kind versteht – nur unsere sieben Bundesräte offenbar nicht.
Die Geschichte einer endlosen Erpressung
Der Abstieg der stolzen Eidgenossenschaft zur devoten Zahlmeisterin begann nicht erst gestern. Schon die Affäre um die nachrichtenlosen Vermögen aus der Nazi-Zeit zeigte, wie leicht sich die Schweiz unter Druck setzen lässt. Es folgte die systematische Demontage des Bankgeheimnisses – ein Kernstück helvetischer Souveränität, das auf dem Altar amerikanischer Machtpolitik geopfert wurde.
Besonders perfide: Während die Schweiz seit 2014 brav über das FATCA-Abkommen sensible Steuerdaten von US-Bürgern an Washington liefert, lachen sich die Amerikaner ins Fäustchen. Sie selbst haben keinerlei Abkommen über den automatischen Informationsaustausch unterzeichnet. Die wahren Steuerparadiese befinden sich heute unter US-Hoheit – Delaware, Nevada, Wyoming. Doch wagt es jemand, diese anzuprangern? Natürlich nicht.
Die OECD-Mindeststeuer: Ein Lehrstück in Naivität
Der nächste Akt in diesem Trauerspiel helvetischer Selbstaufgabe folgte 2021. Auf massiven Druck der USA beschloss die OECD eine Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen. Die Schweiz, stets bemüht, als braver Musterschüler zu gelten, setzte diese eilfertig um. 140 Länder folgten dem Diktat.
Und heute? Die USA pfeifen auf ihre eigenen Forderungen. Während die Schweiz ihre Standortvorteile aufgab, droht Washington sogar mit massiven Gegenmassnahmen, sollte jemand wagen, amerikanische Digitalkonzerne zu besteuern. Die Rechnung für diese Naivität zahlen Schweizer Unternehmen und Steuerzahler.
Der aktuelle Zollhammer: Trumps Meisterstück
Nun also der vorläufige Höhepunkt: 39 Prozent Zölle auf Schweizer Exporte. Dies, obwohl die Schweiz pro Kopf dreimal so viele Waren aus den USA importiert wie die EU. Noch grotesker: Pro Einwohner kauft die Schweiz 15-mal mehr amerikanische Produkte als umgekehrt. Doch solche Fakten interessieren in Washington niemanden.
Die Reaktion aus Bern? Achselzucken und der Verweis auf "Schicksal". Bundesrätin Karin Keller-Sutter scheint die Kunst des Verhandelns nicht zu beherrschen – oder will es nicht. Während andere Länder ihre Interessen verteidigen, übt sich die Schweiz in vorauseilendem Gehorsam.
Die EU-Turbos wittern Morgenluft
Wie Aasgeier stürzen sich nun die EU-Befürworter auf die Situation. Die Lösung aller Probleme? Natürlich die "Bilateralen III" – ein 1800-seitiges Unterwerfungsdokument, das die Schweiz endgültig zum Vasallen Brüssels degradieren würde. Verschwiegen wird dabei gerne, dass dieser Knebelvertrag Kohäsionszahlungen von 2 bis 3 Milliarden Franken über zehn Jahre vorsieht. Nicht mehr als freiwillige Leistung, sondern als Verpflichtung.
Die wahren Kosten liegen jedoch in der automatischen Rechtsübernahme. Wer nicht spurt, zahlt "Ausgleichsmassnahmen" – ein Euphemismus für Strafgelder. Die vielzitierte Guillotine-Klausel hängt wie ein Damoklesschwert über jedem Versuch, die masslose Zuwanderung auch nur ansatzweise zu begrenzen.
Die Wirtschaft zwischen Panik und Opportunismus
Besonders grotesk gebärdet sich der Maschinenindustrie-Verband Swissmem. Einerseits befürchtet man, Schweizer KMUs müssten Teile ihrer Produktion in die EU verlagern. Andererseits fordert man die Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monate. Gleichzeitig wird über Fachkräftemangel gejammert. Diese Widersprüche stören offenbar niemanden – Hauptsache, die "Bilateralen III" kommen schnell unter Dach und Fach.
Einige Unternehmen werden die Kombination aus 39 Prozent Zöllen und der Dollarabwertung nicht verkraften. Sie werden ihre US-Geschäfte einstellen müssen. Ironischerweise könnte dies zu Lieferengpässen bei lebensrettenden Medikamenten oder kritischen Maschinenteilen in den USA führen. Doch auch das wird Trump kaum beeindrucken.
Die verpassten Chancen
Dabei hätte die Schweiz durchaus Verhandlungsmasse. Mehr Waffenkäufe, verstärkte Energieimporte aus den USA – solche Angebote könnten die Wogen glätten. Doch die politische Linke würde Zeter und Mordio schreien. Also bleibt man lieber passiv und hofft auf ein Wunder bis zum 7. August, wenn die Nachverhandlungsfrist abläuft.
Die Alternative wäre eine Rückbesinnung auf wahre Neutralität und Unabhängigkeit. Statt sich zwischen den Mühlsteinen USA und EU zerreiben zu lassen, könnte die Schweiz neue Märkte erschliessen. Die BRICS-Staaten repräsentieren einen wachsenden Teil der Weltwirtschaft. Doch dafür müsste man erst einmal die selbstverschuldete Isolation durch die einseitige Parteinahme im Ukraine-Konflikt überwinden.
Das Fazit: Zeit für einen Kurswechsel
Die aktuelle Situation offenbart schonungslos das Versagen der Schweizer Politik. Wer glaubt, durch Unterwürfigkeit Wohlwollen zu erkaufen, wird immer wieder enttäuscht werden. Die USA behandeln die Schweiz nicht als Partner, sondern als Melkkuh. Die EU nicht anders.
Es bräuchte eine Regierung mit Rückgrat, die Schweizer Interessen verteidigt statt sie zu verscherbeln. Eine Politik, die auf Augenhöhe verhandelt statt auf Knien zu rutschen. Vor allem aber: Ein Ende der Selbstaufgabe zugunsten fremder Mächte.
Die Rechnung für jahrzehntelange Feigheit wird nun präsentiert. Ob die Schweiz daraus lernt oder sich noch tiefer in die Abhängigkeit begibt, werden die kommenden Monate zeigen. Die Zeichen stehen allerdings schlecht – zu bequem ist die Position des braven Zahlmeisters geworden. Doch eines sollte klar sein: Wer seine Souveränität aufgibt, wird sie nicht durch noch mehr Unterwürfigkeit zurückgewinnen.
"Ein Land, das neutral ist, kann man nicht erpressen", schrieb ein Leser treffend. Doch die Schweiz hat ihre Neutralität längst auf dem Altar der Anbiederung geopfert. Der Preis dafür wird nun fällig – in harter Währung und verlorener Würde.
- Themen:
- #Steuern

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik












