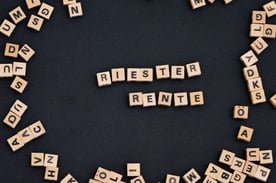Trumps Justizministerium feuert Habbas Nachfolgerin – Ein Schlag gegen aktivistische Richter
In einem beispiellosen Machtkampf zwischen Exekutive und Judikative hat das US-Justizministerium unter Präsident Donald Trump einen bemerkenswerten Schritt gewagt. Nur wenige Stunden nach ihrer Ernennung durch ein Bundesrichtergremium wurde Desiree Leigh Grace, die frisch ernannte US-Staatsanwältin für New Jersey, wieder ihres Amtes enthoben. Ein Vorgang, der die Frage aufwirft: Wer regiert eigentlich Amerika – gewählte Politiker oder selbsternannte Richter-Aktivisten?
Der Hintergrund des Konflikts
Die Wurzeln dieses Konflikts reichen zurück bis zur Ernennung von Alina Habba, Trumps ehemaliger Anwältin, zur Interims-Staatsanwältin von New Jersey. Habba, die Trump erfolgreich in mehreren Verfahren verteidigte, darunter der Verleumdungsklage der Autorin E. Jean Carroll, sollte nach dem Willen des Präsidenten dauerhaft in dieser Position bleiben. Doch nach Ablauf ihrer gesetzlich begrenzten 120-tägigen Amtszeit griffen die Bundesrichter von New Jersey ein – und ersetzten sie kurzerhand durch ihre Stellvertreterin Grace.
Was folgte, war eine unmissverständliche Reaktion aus Washington. Justizministerin Pam Bondi verkündete noch am selben Tag über die sozialen Medien, dass Grace mit sofortiger Wirkung entlassen sei. Ihre Begründung: "Politisch motivierte Richter" hätten sich geweigert, Habba in ihrer Position zu belassen, obwohl diese "großartige Arbeit" dabei geleistet habe, New Jersey "wieder sicher zu machen".
Ein Kampf um die Gewaltenteilung?
Die demokratischen Senatoren von New Jersey, Cory Booker und Andy Kim, schäumten vor Wut. In einer gemeinsamen Erklärung warfen sie der Trump-Administration vor, ein Gericht zu kritisieren, das lediglich "im Rahmen seiner Befugnisse" gehandelt habe. Sie sprachen von einem "eklatanten Versuch, jeden einzuschüchtern, der nicht ihrer Meinung ist" und von einer Untergrabung der richterlichen Unabhängigkeit.
"Diese Regierung mag das Gesetz nicht mögen, aber sie steht nicht darüber. Die Menschen in New Jersey verdienen einen US-Staatsanwalt, der das Gesetz durchsetzt und Gerechtigkeit für die Menschen unseres Staates verfolgt – ohne Parteilichkeit oder Politik."
Doch ist diese Empörung wirklich gerechtfertigt? Oder zeigt sich hier vielmehr ein grundlegendes Problem des amerikanischen Justizsystems, in dem aktivistische Richter zunehmend versuchen, die Entscheidungen demokratisch gewählter Amtsträger zu untergraben?
Die rechtliche Grauzone
Nach geltendem Bundesrecht können Bezirksgerichte eingreifen, wenn ein Interims-Staatsanwalt nach 120 Tagen noch nicht vom Senat bestätigt wurde. Doch die Frage bleibt: Sollten Richter wirklich die Macht haben, Personalentscheidungen der Exekutive zu überstimmen? Todd Blanche, der stellvertretende Justizminister, brachte es auf den Punkt: "Diese Hinterzimmer-Abstimmung wird die Autorität des obersten Exekutivbeamten nicht außer Kraft setzen."
Ein Symptom eines größeren Problems
Dieser Vorfall ist symptomatisch für ein tieferliegendes Problem in den USA – und zunehmend auch in Deutschland. Immer häufiger maßen sich nicht gewählte Richter an, politische Entscheidungen zu treffen, die eigentlich in die Zuständigkeit der Legislative oder Exekutive fallen. In Deutschland erleben wir ähnliche Tendenzen, wenn Verfassungsrichter zunehmend als politische Akteure auftreten und Entscheidungen treffen, die weit über ihre eigentliche juristische Kompetenz hinausgehen.
Die Parallelen sind unübersehbar: Hier wie dort versuchen progressive Kräfte, über die Hintertür der Justiz politische Ziele durchzusetzen, die sie auf demokratischem Wege nicht erreichen können. Es ist höchste Zeit, dass gewählte Volksvertreter – ob in Washington oder Berlin – diesem Treiben Einhalt gebieten.
Was bedeutet das für die Zukunft?
Der Fall Habba könnte einen Präzedenzfall schaffen. Wenn die Trump-Administration sich durchsetzt, wäre das ein klares Signal an aktivistische Richter überall im Land: Die Exekutive lässt sich ihre verfassungsmäßigen Befugnisse nicht von einer politisierten Justiz aus der Hand nehmen. Für konservative Kräfte, die seit Jahren gegen die Übergriffe einer linken Richterschaft kämpfen, wäre das ein wichtiger Sieg.
Gleichzeitig zeigt dieser Konflikt, wie tief die Gräben in der amerikanischen Gesellschaft mittlerweile sind. Wenn selbst die Besetzung eines Staatsanwaltspostens zu einem erbitterten Machtkampf zwischen den Gewalten führt, steht die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems auf dem Spiel. Eine Entwicklung, die auch für Deutschland eine Warnung sein sollte – denn auch hier versuchen progressive Kräfte zunehmend, über die Justiz Politik zu machen.
Am Ende bleibt die Frage: Wer soll in einer Demokratie das letzte Wort haben – gewählte Politiker oder ernannte Richter? Die Antwort darauf wird nicht nur über die Zukunft von New Jerseys Staatsanwaltschaft entscheiden, sondern über die Zukunft der amerikanischen Demokratie selbst.
- Themen:
- #Wahlen

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik