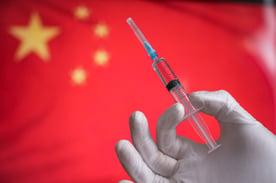Massenentlassungen bei VW: Wenn deutsche Arbeitsplätze zur Manövriermasse werden
Während die Politik von "Fachkräftemangel" schwadroniert und Millionen für fragwürdige Integrationsprojekte verpulvert, zeigt sich bei Deutschlands einstigem Vorzeige-Konzern die bittere Realität: Volkswagen hat in diesem Jahr bereits über 500 Mitarbeiter vor die Tür gesetzt. Allein an den sechs deutschen Standorten flogen mehr als 300 Beschäftigte raus – ein Kahlschlag, der Fragen aufwirft.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache
Was der Konzern euphemistisch als "Fehlverhalten" bezeichnet, offenbart bei genauerer Betrachtung ein tieferliegendes Problem. Unentschuldigtes Fehlen sei einer der Hauptgründe, heißt es aus Wolfsburg. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Hier manifestiert sich die schleichende Erosion deutscher Arbeitskultur. Wenn Mitarbeiter massenhaft ihrer Arbeit fernbleiben, stimmt etwas Grundlegendes nicht mehr.
Die internen Statistiken, die als Konsequenz aus dem Dieselskandal eingeführt wurden, legen schonungslos offen, was viele längst ahnen: Der einst stolze Automobilriese kämpft nicht nur gegen technologischen Wandel und internationale Konkurrenz, sondern auch gegen hausgemachte Probleme. 548 Kündigungen weltweit im ersten Halbjahr 2025 – das sind keine Einzelfälle mehr, das ist ein Trend.
Symptom einer kranken Wirtschaftspolitik
Während die Große Koalition unter Friedrich Merz vollmundig von einem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur faselt und die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz verankert, bröckelt das Fundament unserer Industrie. Die Realität in deutschen Werkhallen passt nicht zu den schönen Sonntagsreden der Politik.
Es drängt sich die Frage auf: Sind diese Massenentlassungen wirklich nur die Folge individuellen Fehlverhaltens? Oder spiegeln sie nicht vielmehr die Frustration einer Belegschaft wider, die zwischen Transformationsdruck, politischen Vorgaben und wirtschaftlicher Unsicherheit zerrieben wird? Wenn Arbeitnehmer reihenweise unentschuldigt fehlen, könnte das auch ein stummer Protest gegen Arbeitsbedingungen sein, die immer unerträglicher werden.
Die wahren Kosten der Transformation
VW steht exemplarisch für die Herausforderungen der deutschen Automobilindustrie. Der erzwungene Umstieg auf Elektromobilität, getrieben von ideologischen Vorgaben statt marktwirtschaftlicher Vernunft, fordert seinen Tribut. Arbeitsplätze, die über Generationen sichere Existenzen garantierten, werden zur Dispositionsmasse einer Politik, die mehr auf internationale Klimakonferenzen schielt als auf die Sorgen der eigenen Bevölkerung.
Die Ironie dabei: Während hierzulande traditionsreiche Arbeitsplätze vernichtet werden, boomt die Automobilproduktion in Ländern mit deutlich laxeren Umweltstandards. Ein klassisches Eigentor deutscher Politik, das am Ende weder dem Klima noch den Menschen hilft.
Zeit für einen Kurswechsel
Was Deutschland braucht, ist keine weitere Verschärfung von Klimazielen oder neue Milliardenschulden für fragwürdige Prestigeprojekte. Was wir brauchen, ist eine Rückbesinnung auf das, was unser Land stark gemacht hat: solide Industriepolitik, die Arbeitsplätze schützt statt vernichtet, und eine Wirtschaftsstrategie, die auf Vernunft statt Ideologie basiert.
Die Massenentlassungen bei VW sollten ein Weckruf sein. Nicht für die betroffenen Mitarbeiter, die ohnehin schon den Preis zahlen, sondern für eine Politik, die endlich verstehen muss: Ohne starke Industrie keine starken Sozialsysteme, ohne sichere Arbeitsplätze kein gesellschaftlicher Zusammenhalt. In Zeiten, in denen physische Werte wie Gold und Silber als Krisenschutz wieder an Bedeutung gewinnen, zeigt sich: Die Menschen haben das Vertrauen in die Versprechen der Politik längst verloren. Zu Recht.
- Themen:
- #CDU-CSU

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik