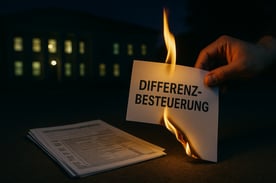Hamburgs Klima-Wahn: Wie sich die Hansestadt mit ideologischer Verbohrtheit selbst ruiniert
Die Hamburger haben es tatsächlich getan. In einem Anfall kollektiver Selbstgeißelung stimmten sie dafür, ihre Stadt bereits bis 2040 statt 2045 klimaneutral zu machen. Was als vermeintlicher Beitrag zum Weltklima verkauft wird, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als wirtschaftlicher Harakiri mit Ansage. Die grün-rote Traumtänzerei am Elbufer könnte der Hansestadt teuer zu stehen kommen – und dem Klima bringt es exakt nichts.
Wenn Symbolpolitik zur Existenzbedrohung wird
Andreas Pfannenberg, Präsident der Hamburger Industrie, bringt es auf den Punkt: Dem Weltklima helfe die Entscheidung "herzlich wenig". Stattdessen drohe ein massiver Arbeitsplatzabbau. Wenn die Stahl- und Kupferproduktion ins Ausland abwandere, werde dort unter schlechteren Umweltstandards produziert – mit deutlich höherem CO₂-Ausstoß. Das sei nichts anderes als "Augenwischerei", so Pfannenberg.
Diese Einschätzung teilt auch Professor Wilfried Rickels vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Der renommierte Klimaökonom warnt eindringlich vor den enormen Kosten, die niemand beim Namen nenne. Wer nicht erklären könne, wie Klimaneutralität technisch und finanziell erreicht werden solle, brauche "auch nicht über Jahreszahlen zu fantasieren".
Die drohende Deindustrialisierung
Was die Klimaromantiker in ihrer ideologischen Verblendung übersehen: Hamburg ist keine isolierte Insel der Glückseligkeit, sondern Teil eines globalen Wirtschaftssystems. Unternehmen, die mit internationaler Konkurrenz kämpfen, werden nicht aus Heimatliebe in Hamburg bleiben, wenn die Produktionsbedingungen unrentabel werden. Sie wandern ab – nach Polen, Tschechien oder gleich nach Asien.
"Wenn einzelne Städte oder Regionen vorpreschen, hat das natürlich Signalwirkung, aber der Nutzen eines geänderten Zieljahres ist erst mal gering."
Professor Michael Berlemann vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut warnt vor den konkreten Folgen für die Bürger. Sollten die verbindlichen Zwischenziele verfehlt werden, drohen Sofortprogramme wie Fahrverbote, die das Leben in Hamburg "erratisch beeinflussen" würden. Der Volkswirtschaftler bezeichnet die Initiative als "exaktes Gegenteil" einer sinnvollen Klimapolitik, die global abgestimmt sein müsse.
Die Rechnung zahlt der Bürger
Während Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) sich für ihre vermeintliche Vorreiterrolle feiern lassen, werden die Hamburger Bürger die Zeche zahlen müssen. Höhere Energiepreise, teurere Mobilität, Arbeitsplatzverluste – die Liste der absehbaren Kollateralschäden ist lang.
Besonders perfide: Die verschärften Klimaziele treffen vor allem jene, die sich keine teuren Alternativen leisten können. Wer nicht das Geld für ein E-Auto hat, wird bei Fahrverboten das Nachsehen haben. Wer in energieintensiven Branchen arbeitet, muss um seinen Job bangen. Die grüne Oberschicht in Blankenese kann sich ihre Klimamoral leisten – der Hafenarbeiter in Wilhelmsburg nicht.
Ein Pyrrhussieg für die Klimabewegung
Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis, dass Hamburg sich mit diesem Volksentscheid keinen Gefallen getan hat. Die Stadt opfert ihre wirtschaftliche Zukunft auf dem Altar einer Klimareligion, die längst jeden Bezug zur Realität verloren hat. Statt pragmatischer Lösungen dominiert ideologische Verbohrtheit.
Die wahre Tragödie: Dem Weltklima ist mit diesem Hamburger Alleingang nicht geholfen. Die Emissionen werden lediglich verlagert – in Länder mit niedrigeren Umweltstandards. Was als moralische Überlegenheit verkauft wird, entpuppt sich als ökonomischer und ökologischer Unsinn.
Hamburg braucht keine Symbolpolitik, sondern vernünftige, technologieoffene Ansätze. Doch dafür müsste man erst einmal die grün-rote Brille abnehmen und der Realität ins Auge blicken. In Zeiten, in denen Ideologie über Vernunft triumphiert, scheint das jedoch zu viel verlangt.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik