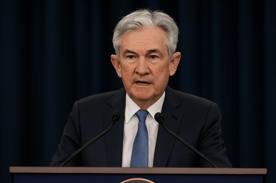Google-Imperium wankt: 425 Millionen Dollar Strafe für dreisten Datenklau
Das Silicon-Valley-Imperium Google muss wieder einmal tief in die Tasche greifen. Ein US-Geschworenengericht verurteilte den Tech-Giganten zu einer Strafzahlung von satten 425 Millionen Dollar. Der Grund: systematischer Datenmissbrauch in einem Ausmaß, das selbst für Google-Verhältnisse bemerkenswert sei. Über acht Jahre hinweg habe der Konzern die Privatsphäre von 98 Millionen Nutzern mit Füßen getreten – und das trotz explizit deaktivierter Tracking-Funktionen.
Der große Datenbetrug: Wenn "Aus" nicht "Aus" bedeutet
Was würde passieren, wenn Sie den Lichtschalter ausschalten, das Licht aber trotzdem weiter brennt? Genau das hat Google seinen Nutzern angetan – nur ging es nicht um Beleuchtung, sondern um höchst sensible persönliche Daten. Nutzer, die glaubten, durch das Deaktivieren der Tracking-Funktion ihre digitale Privatsphäre zu schützen, wurden eines Besseren belehrt. Der Konzern sammelte munter weiter: Standortdaten, Suchverläufe, App-Nutzungsverhalten – das volle Programm der digitalen Überwachung.
Die Dimension des Skandals ist erschreckend: 174 Millionen Geräte seien betroffen gewesen. Man stelle sich vor: Fast die Hälfte der US-Bevölkerung wurde systematisch ausgespäht, obwohl sie explizit ihre Zustimmung verweigert hatte. In einer Zeit, in der unsere Regierung ständig von Datenschutz und digitaler Souveränität spricht, zeigt dieser Fall einmal mehr, wie hilflos Bürger den Tech-Konzernen ausgeliefert sind.
Googles fadenscheinige Ausreden
Die Reaktion des Konzerns auf das vernichtende Urteil ist typisch für die Arroganz der Tech-Elite. Google behauptet allen Ernstes, die gesammelten Daten seien "nicht personenbezogen" und "pseudonym" gewesen. Eine Aussage, die bei jedem, der sich auch nur oberflächlich mit Datenanalyse auskennt, ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen dürfte. Pseudonyme Daten lassen sich mit den heutigen technischen Möglichkeiten problemlos wieder einzelnen Personen zuordnen – das weiß niemand besser als Google selbst.
"Diese Entscheidung missversteht, wie unsere Produkte funktionieren"
So lautet die patzige Antwort eines Google-Sprechers. Doch wer missversteht hier eigentlich was? Es scheint eher so, als hätte Google bewusst missverstanden, was "Datenschutz respektieren" bedeutet. Der Konzern kündigt bereits Berufung an – ein weiterer Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Ein Tropfen auf den heißen Stein
425 Millionen Dollar mögen nach viel Geld klingen, doch für Google ist das nicht mehr als Portokasse. Der Mutterkonzern Alphabet erwirtschaftete allein im letzten Quartal einen Gewinn von über 23 Milliarden Dollar. Die Strafe entspricht also gerade einmal dem, was Google in weniger als zwei Tagen verdient. Kann das wirklich abschreckend wirken?
Die eigentliche Frage ist: Warum lassen wir es zu, dass ausländische Tech-Konzerne derart dreist mit unseren Daten umgehen? Während unsere Bundesregierung sich in endlosen Debatten über Gendern und Klimaneutralität verliert, plündern amerikanische Großkonzerne ungestraft die digitalen Identitäten der Bürger. Es bräuchte endlich eine Politik, die deutsche und europäische Interessen verteidigt, statt sich von der Lobby-Macht des Silicon Valley einschüchtern zu lassen.
Die Monopol-Frage bleibt ungelöst
Parallel zu diesem Datenskandal läuft ein weiteres Verfahren gegen Google wegen illegaler Monopolbildung. Erst kürzlich lehnte ein US-Gericht die Zerschlagung des Konzerns ab – ein fatales Signal. Denn solange Google seine marktbeherrschende Stellung behält, werden solche Datenschutzverletzungen zur Normalität. Der Konzern kontrolliert über 90 Prozent des weltweiten Suchmaschinenmarktes und kann praktisch schalten und walten, wie es ihm beliebt.
Es ist höchste Zeit, dass Europa eigene digitale Champions aufbaut, statt sich der Willkür amerikanischer Tech-Giganten auszuliefern. Doch dafür bräuchte es eine Wirtschaftspolitik, die Unternehmertum fördert statt es mit immer neuen Regulierungen zu ersticken. Die aktuelle Große Koalition unter Friedrich Merz hatte versprochen, Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen. Bisher sehen wir davon wenig.
Was bedeutet das für den Anleger?
In Zeiten, in denen Tech-Konzerne ihre Macht missbrauchen und Regierungen versagen, gewinnen krisensichere Anlagen an Bedeutung. Während Aktien von Unternehmen wie Google trotz aller Skandale weiter steigen mögen, sollten kluge Anleger über Diversifikation nachdenken. Physische Edelmetalle wie Gold und Silber bieten hier eine bewährte Alternative. Sie unterliegen keiner digitalen Überwachung, können nicht per Mausklick entwertet werden und haben sich über Jahrtausende als Wertspeicher bewährt. In einem ausgewogenen Portfolio sollten sie daher nicht fehlen – gerade in Zeiten zunehmender digitaler und politischer Unsicherheit.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik