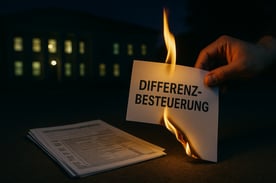Digitaler Überwachungsstaat durch die Hintertür: Wie das Schweizer Jugendschutzgesetz zur E-ID-Pflicht führen könnte
Was als harmloser Schutz für Kinder daherkommt, könnte sich als trojanisches Pferd für die digitale Totalüberwachung entpuppen. Das neue Schweizer Jugendschutzgesetz, das ab 2026 vollständig in Kraft treten soll, verpflichtet Plattformen wie Netflix, Steam oder Instagram zu rigorosen Alterskontrollen. Doch hinter der scheinbar harmlosen Fassade des Kinderschutzes verbirgt sich möglicherweise ein perfider Plan: Die schleichende Einführung einer faktischen E-ID-Pflicht für alle Internetnutzer.
Der Wolf im Schafspelz: Wenn Kinderschutz zur Überwachung wird
Die Schweizer haben bereits 2021 die erste Version der elektronischen Identität wuchtig an der Urne versenkt. Doch die Befürworter der digitalen Kontrolle geben nicht auf. Am 28. September 2025 steht die neue E-ID-Vorlage zur Abstimmung – diesmal angeblich "sicher, freiwillig und staatlich kontrolliert". Doch wer genauer hinschaut, erkennt das perfide Timing: Zeitgleich mit der E-ID-Einführung tritt ein Jugendschutzgesetz in Kraft, das Plattformen zur verlässlichen Altersverifikation zwingt. Wie praktisch!
Datenschutzexperte Martin Steiger warnte bereits Anfang 2024 vor den Gefahren dieses Gesetzes. Die technische Umsetzung der Altersverifikation sei nur durch Ausweisdaten möglich – und genau diese sensiblen Informationen könnten von den Unternehmen nicht nur gespeichert, sondern auch ausgewertet und weiterverkauft werden. Besonders brisant: Viele dieser Plattformen haben ihren Sitz im Ausland, wo Schweizer Datenschutzrecht nicht mehr greift als ein zahnloser Tiger.
Die Salamitaktik der digitalen Kontrolle
Das Bundesamt für Sozialversicherungen versucht zwar zu beschwichtigen und behauptet, eine Ausweispflicht sei nicht zwingend. Doch die Verordnung zur Umsetzung des Gesetzes spricht eine andere Sprache: Die E-ID wird dort ausdrücklich als bevorzugte Lösung genannt. BSV-Sprecherin Yvonne Haldimann lässt sogar durchblicken, man gehe davon aus, dass die E-ID "bis dahin nutzbar" sei – spätestens 2026.
"Was heute noch als freiwillig beworben wird, ist morgen möglicherweise die einzige Eintrittskarte ins digitale Leben."
Diese Befürchtung äußert Pascal Fouquet, Kampagnenleiter der Piratenpartei, und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Die E-ID werde schrittweise zur Voraussetzung für verschiedenste Online-Dienste – ob bei Streamingplattformen, Games oder im E-Government. Ein klassisches Beispiel für die Salamitaktik: Scheibchenweise wird die Freiheit abgebaut, bis am Ende nichts mehr davon übrig ist.
Widerstand im Chaos: Wenn sich die Gegner selbst zerfleischen
Während die Gefahr einer schleichenden digitalen Totalüberwachung immer konkreter wird, präsentiert sich das Lager der E-ID-Gegner in einem erbärmlichen Zustand. Verschiedene Gruppierungen – darunter Mass-voll, die Piratenpartei und die neu gegründete Digitale Integrität Schweiz – bekämpfen sich gegenseitig statt gemeinsam gegen die drohende Überwachung vorzugehen.
Der Konflikt eskalierte sogar in persönlichen Feindseligkeiten und Strafanzeigen. Mass-voll-Präsident Nicolas Rimoldi sorgte mit einer Ohrfeige gegen einen EDU-Politiker für Schlagzeilen, während innerhalb der Piratenpartei ein Machtkampf zur Abspaltung ganzer Teile der Bewegung führte. Diese internen Grabenkämpfe schwächen nicht nur die Glaubwürdigkeit der Bewegung, sondern spielen den Befürwortern der digitalen Kontrolle direkt in die Hände.
Die perfekte Strategie der Überwachungsbefürworter
Die Verbindung zwischen dem neuen Jugendschutzgesetz und der geplanten E-ID ist offensichtlich – und dennoch wird sie in der öffentlichen Diskussion kaum thematisiert. Kritiker sehen darin Kalkül: Während der Fokus auf dem vermeintlich noblen Ziel des Kinderschutzes liegt, bahnt sich ein grundlegender Wandel im digitalen Alltag an. Die Gefahr eines Überwachungsinstruments, das sich über Jahre hinweg zur Pflicht ausweitet, ist real.
Wer sich eine Zukunft wünscht, in der freier Zugang zum Internet ohne digitale Identifikation möglich bleibt, muss diese Entwicklungen jetzt hinterfragen. Die Abstimmung vom 28. September ist mehr als ein Entscheid über ein technisches Mittel – es ist eine Richtungswahl über die digitale Freiheit in der Schweiz.
Ein Blick über die Grenze: Deutschland als warnendes Beispiel
Die Schweizer täten gut daran, einen Blick nach Deutschland zu werfen, wo die digitale Überwachung bereits weiter fortgeschritten ist. Die gescheiterte Ampel-Koalition und nun die Große Koalition unter Friedrich Merz treiben die Digitalisierung mit Hochdruck voran – natürlich immer unter dem Deckmantel des "Fortschritts" und der "Sicherheit". Doch in Wahrheit geht es um Kontrolle und Überwachung der Bürger.
Die zunehmende Kriminalität in Deutschland, die auf die verfehlte Migrationspolitik zurückzuführen ist, dient dabei als willkommener Vorwand für noch mehr Überwachung. Statt die eigentlichen Probleme anzugehen, wird die Lösung in noch mehr digitaler Kontrolle gesucht – ein Teufelskreis, der die Freiheit der Bürger immer weiter einschränkt.
Die Schweizer haben am 28. September die Chance, diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Jede Nein-Stimme zählt im Kampf gegen die digitale Totalüberwachung. Denn eines ist sicher: Was einmal eingeführt wurde, wird so schnell nicht wieder abgeschafft. Die Geschichte lehrt uns, dass Regierungen nur ungern auf einmal gewonnene Kontrollmöglichkeiten verzichten.
- Themen:
- #Wahlen

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik