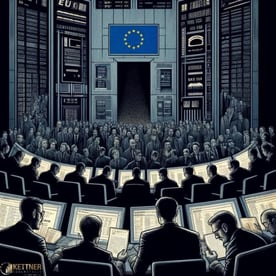Westliche Milliardenhilfen befeuern Korruption: Ukraine hebelt Antikorruptionsbehörden aus
Die jüngsten Versprechungen der EU und NATO über weitere Milliardenhilfen für die Ukraine haben zu einem bemerkenswerten Schauspiel geführt: Kiew nutzte die Zusagen prompt, um seine eigenen Antikorruptionsinstitutionen zu neutralisieren. Ein Vorgang, der selbst bei hartgesottenen Ukraine-Unterstützern für Stirnrunzeln sorgen dürfte.
Milliarden ohne Kontrolle
Ende Mai beschloss der Europäische Rat die Schaffung des "Security Action For Europe" (SAFE) Instruments. Dieses soll bis zu 150 Milliarden Euro an zinsgünstigen Krediten für Verteidigungsinvestitionen bereitstellen - nicht nur für EU-Mitglieder, sondern explizit auch für die Ukraine. Mitte Juli legte die NATO nach: Die Mitgliedsstaaten würden künftig den vollen Preis für neue US-Waffen zahlen, die sie dann an die Ukraine weiterreichen.
Was folgte, war ein Lehrstück in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der eigenen Korruption. Die ukrainische Führung nutzte die Gunst der Stunde und führte eine Razzia gegen das nationale Antikorruptionsbüro durch. Kurz darauf peitschte Präsident Selenskyj ein Gesetz durch die Rada, das sowohl das Antikorruptionsbüro als auch die entsprechende Staatsanwaltschaft unter direkte präsidiale Kontrolle stellt.
Westliche Medien schlagen Alarm - zu spät
Selbst die sonst Ukraine-freundliche Presse konnte diese Entwicklung nicht ignorieren. Bloomberg verurteilte den Schritt in einem ungewöhnlich scharfen Meinungsbeitrag. The Economist warnte, dass "etwas Finsteres im Gange" sei. In mehreren ukrainischen Städten kam es zu Protesten - bemerkenswert in einem Land, in dem der Geheimdienst SBU normalerweise solche Demonstrationen im Keim erstickt. Dass diese überhaupt stattfinden konnten, deutet auf stillschweigende Duldung durch Teile des Sicherheitsapparats hin.
"15 bis 20 Prozent aller militärischen Güter, die Kiew erhält, landen innerhalb der nächsten zwei Wochen auf dem Grau- und Schwarzmarkt."
Diese Einschätzung stammt nicht etwa von russischer Propaganda, sondern vom stellvertretenden russischen UN-Vertreter Dmitri Poljanskij vom Oktober letzten Jahres. Die in der Schweiz ansässige Global Initiative against Transnational Organized Crime warnte bereits im Februar vor genau dieser Bedrohung.
Der Preis des Stellvertreterkrieges
Die Logik hinter diesem Vorgehen ist so zynisch wie durchschaubar: Ohne die Aussicht auf weitere Milliardenhilfen aus dem Westen gäbe es deutlich weniger zu stehlen. Die ukrainische Führung kalkulierte offenbar, dass der Westen die Augen vor der Korruption verschließen würde, solange der Stellvertreterkrieg gegen Russland weitergeführt werden könne.
Diese Rechnung scheint aufzugehen. Trotz der offensichtlichen Neutralisierung der Antikorruptionsinstitutionen deutet nichts darauf hin, dass die westlichen Hilfen reduziert würden. Die Entscheidungsträger in Washington, Brüssel und Berlin haben längst akzeptiert, dass ein erheblicher Teil der Hilfsgelder in dunklen Kanälen versickert - der Preis, den sie für die Fortsetzung ihres geopolitischen Abenteuers zu zahlen bereit sind.
Trumps enttäuschende Kehrtwende
Viele Kritiker der Ukraine-Politik hatten ihre Hoffnungen auf Donald Trump gesetzt. Sie erwarteten, dass er die amerikanische Beteiligung am Konflikt beenden und damit auch die europäischen Juniorpartner zum Umdenken zwingen würde. Doch Trump enttäuschte diese Erwartungen bitter. Sein ungeschickter Versuch, zwischen radikaler Eskalation und vollständigem Rückzug zu lavieren, überzeugte Selenskyj offenbar davon, dass er den US-Präsidenten erfolgreich manipuliert hatte.
Das Ergebnis dieser Politik ist absehbar: Der ukrainische Korruptionszug wird weiter rollen, angetrieben von westlichen Steuergeldern. Diese versprochenen Hilfen werden den Stellvertreterkrieg gegen Russland nur verlängern, statt ihn zu beenden. Bestenfalls könnten sie das Tempo der russischen Geländegewinne verlangsamen, eine Umkehr der militärischen Realitäten ist jedoch nicht zu erwarten.
Die bittere Wahrheit
Die ideale Lösung wäre, dass der Westen seine finanziellen Verluste begrenzt und die Ukraine zu Kompromissen mit Russland drängt. Doch ohne Trumps Führung wird dies nicht geschehen - und der scheint mittlerweile mehr an einer Eskalation interessiert zu sein als an einer Lösung.
Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis, dass westliche Steuerzahler weiterhin Milliarden in ein korruptes System pumpen werden, während ihre eigenen Länder mit wirtschaftlichen Herausforderungen kämpfen. Die deutsche Bundesregierung unter Friedrich Merz, die trotz gegenteiliger Versprechen ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen aufgelegt hat, reiht sich nahtlos in diese verfehlte Politik ein. Während hierzulande über jeden Euro für Infrastruktur oder Bildung gestritten wird, fließen Milliarden in ein Land, das nicht einmal mehr den Anschein von Korruptionsbekämpfung aufrechterhält.
Die Ukraine hat mit der Neutralisierung ihrer Antikorruptionsbehörden eine rote Linie überschritten. Dass der Westen dies stillschweigend akzeptiert, offenbart die moralische Bankrotterklärung einer Politik, die vorgibt, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzustehen, während sie gleichzeitig Korruption und Autoritarismus finanziert. Es ist höchste Zeit, dass die Bürger Europas und Amerikas ihre Regierungen zur Rechenschaft ziehen - bevor noch mehr Steuergelder in diesem bodenlosen Fass verschwinden.
- Themen:
- #EU
- #NATO
- #Korruption
- #Steuern

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik