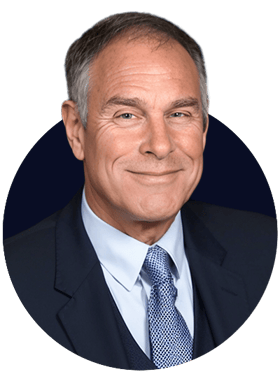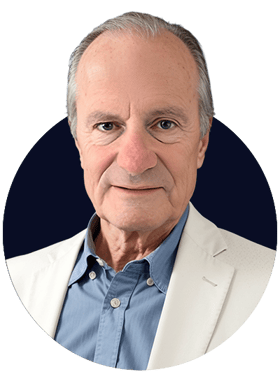Trump entlarvt die G7-Farce: Wenn 29 Prozent sich für die Weltregierung halten
Der Paukenschlag kam, wie bei Donald Trump üblich, ohne diplomatisches Vorgeplänkel: Der US-Präsident verließ das G7-Treffen in den Rocky Mountains vorzeitig und sprach damit aus, was längst jeder weiß, aber keiner zu sagen wagt. Die einst mächtige Gruppe der sieben führenden Industrienationen sei zu einem bedeutungslosen Debattierclub verkommen – ein Anachronismus, der sich weigere, die Realitäten des 21. Jahrhunderts anzuerkennen.
Von der Wirtschaftsmacht zum Papiertiger
Als der französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing 1975 seine Amtskollegen zu einem gemütlichen Kamingespräch auf Schloss Rambouillet einlud, repräsentierten die damals noch sechs Staaten stolze 45 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Ein halbes Jahrhundert später ist von dieser Dominanz wenig geblieben: Gerade einmal 29 Prozent der Weltwirtschaft entfallen heute auf die mittlerweile sieben Mitglieder. Dennoch gebärden sich die G7-Staaten weiterhin wie eine Art Weltregierung – mit nur zehn Prozent der Weltbevölkerung im Rücken.
Die wahren Machtverhältnisse haben sich längst verschoben. Die von China angeführten BRICS-Staaten repräsentieren mittlerweile 48 Prozent der Weltbevölkerung und beeindruckende 38 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Während die G7 in endlosen Kommuniqués ihre vermeintliche moralische Überlegenheit zelebrieren, gestalten andere die wirtschaftliche Zukunft des Planeten.
Die Demokratie-Heuchelei des Westens
Besonders pikant wird es, wenn die G7 ihre Existenzberechtigung mit dem Verweis auf gemeinsame demokratische Werte begründen. Diese Schutzbehauptung wirkt angesichts der Realität geradezu grotesk: EU und USA bezichtigen sich gegenseitig auf offener Bühne, es mit demokratischen Prinzipien nicht allzu genau zu nehmen. Während Brüssel Washington mangelnde Rechtsstaatlichkeit vorwirft, kontert Amerika mit Kritik an der demokratischen Legitimation der EU-Institutionen.
„Die G7 maßen sich die Rolle einer Weltregierung an – mit nur 10 Prozent der Weltbevölkerung."
Trump, der für seine unverblümte Art bekannt ist, hat mit seinem Abgang lediglich die Konsequenz aus dieser Farce gezogen. Sein Vorschlag, die Gruppe um Indien und Südkorea zu erweitern, würde am grundsätzlichen Problem allerdings wenig ändern. Eine wirkliche Reform müsste viel radikaler ausfallen: Italien, Frankreich und Deutschland könnten durch eine einheitliche EU-Vertretung ersetzt werden. Vor allem aber müsste China mit am Tisch sitzen – doch genau das verhindern Trumps ideologische Scheuklappen und die Angst des Westens vor dem Machtverlust.
Die neue Weltordnung akzeptieren oder untergehen
Die G7 stehen vor einer existenziellen Entscheidung: Entweder sie öffnen sich für die neuen Machtzentren der Welt und akzeptieren ihre schwindende Bedeutung, oder sie verharren in ihrer selbstgewählten Bedeutungslosigkeit. Die jährlichen Gipfeltreffen mit ihren aufgeblähten Delegationen, endlosen Arbeitsgruppen und nichtssagenden Abschlusserklärungen sind längst zur teuren Folklore verkommen.
Was einst als informeller Austausch unter Gleichgesinnten begann, erstickt heute in Gigantomanie und Selbstüberschätzung. Während die G7-Staaten noch über Klimaziele und Menschenrechte philosophieren, schmieden China und seine Partner längst die Handelsabkommen und Infrastrukturprojekte, die die Weltwirtschaft der kommenden Jahrzehnte prägen werden.
Trumps Eklat mag diplomatisch ungeschickt gewesen sein, doch er hat eine überfällige Debatte angestoßen. Die Frage ist nicht, ob die G7 reformiert werden müssen, sondern ob sie in ihrer jetzigen Form überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben. In einer multipolaren Welt, in der Asien und Afrika zunehmend selbstbewusst auftreten, wirkt ein exklusiver Club westlicher Industriestaaten wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten – ein Anachronismus, der sich weigert, in der Gegenwart anzukommen.
- Themen:
- #Wahlen
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
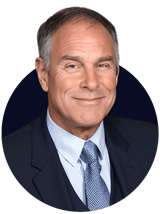
Rick Rule
Rohstoff-Legende
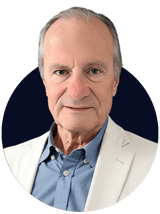
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik