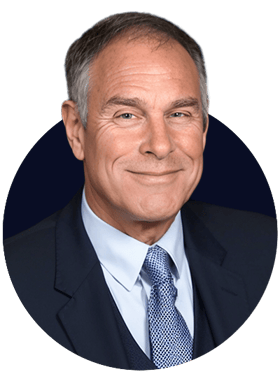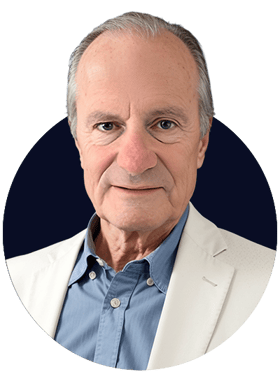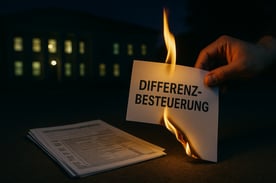Merz' Reservisten-Plan: Wenn die Wirtschaft für die Bundeswehr bluten soll
Bundeskanzler Friedrich Merz hat beim Tag der Industrie seine neueste Vision präsentiert: Deutsche Unternehmen sollen ihre Mitarbeiter als Reservisten für die Bundeswehr abstellen. Was auf den ersten Blick wie eine patriotische Geste klingt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als weiterer Baustein in der endlosen Kette staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft.
Die schöne neue Welt der Zwangssolidarität
Der Plan des Bundeskanzlers klingt zunächst verlockend: Unternehmen würden vollständig von den Lohnkosten entlastet, wenn ihre Mitarbeiter als Reservisten üben. Doch wer glaubt, dass es bei dieser "freiwilligen" Unterstützung bleiben wird, kennt die deutsche Politik schlecht. Was heute als Bitte formuliert wird, könnte morgen schon zur gesetzlichen Pflicht werden - die Geschichte lehrt uns, dass der Staat seine Forderungen selten zurücknimmt.
Besonders pikant: Während die Bundesregierung einerseits von Bürokratieabbau spricht, schafft sie andererseits neue administrative Hürden für Unternehmen. Der bürokratische Aufwand für die Freistellung von Reservisten mag finanziell kompensiert werden, doch die Zeit und Ressourcen, die in die Verwaltung fließen, bleiben unberücksichtigt.
34.000 statt 170.000 - das Versagen der Politik
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Deutschland verfügt derzeit über lediglich 34.000 Reservisten - ein Fünftel dessen, was im Konfliktfall benötigt würde. Dieses eklatante Versagen ist das Resultat jahrzehntelanger Fehlentscheidungen. Die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 unter Angela Merkel war ein historischer Fehler, dessen Folgen wir heute bitter spüren.
"Das sind alles Eigenschaften, die in Unternehmen eine große Rolle spielen", erklärt Hans-Jürgen Völz vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft über die Qualifikationen von Reservisten. Doch wenn diese Eigenschaften so wertvoll sind, warum sollten Unternehmen dann auf ihre besten Mitarbeiter verzichten?
Die Wirtschaft als Reparaturbetrieb politischer Fehler
Es ist bezeichnend für die aktuelle Politik, dass wieder einmal die Wirtschaft die Suppe auslöffeln soll, die die Politik eingebrockt hat. Statt endlich über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht nachzudenken - eine Maßnahme, die für echte Wehrgerechtigkeit sorgen würde - versucht man es mit halbherzigen Flickschustereien.
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Thüringen hofft auf Freiwilligkeit statt gesetzlichen Zwang. Diese Hoffnung dürfte sich als trügerisch erweisen. Denn wenn die freiwilligen Zahlen nicht stimmen - und das werden sie nicht - wird der Staat zur Zwangsmaßnahme greifen. Das kennen wir bereits aus anderen Bereichen.
Der wahre Preis der "kostenlosen" Freistellung
Die vollständige Entlastung von Lohnkosten mag auf dem Papier gut aussehen, doch wer zahlt am Ende die Rechnung? Natürlich der Steuerzahler - also genau die Unternehmen und Bürger, die man vorgibt zu entlasten. Es ist das alte Spiel: Mit der einen Hand gibt der Staat, mit der anderen nimmt er doppelt.
Zudem ignoriert diese Rechnung die indirekten Kosten: Projekte, die liegen bleiben, Kunden, die nicht bedient werden können, Know-how, das temporär fehlt. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen kann der Ausfall eines Schlüsselmitarbeiters existenzbedrohend sein.
Ein Blick in die Zukunft
Was als "Unterstützung" der Bundeswehr beginnt, könnte sich schnell zu einer weiteren Belastung für die ohnehin gebeutelte deutsche Wirtschaft entwickeln. In Zeiten, in denen Unternehmen mit Energiekosten, Bürokratie und internationalem Wettbewerbsdruck kämpfen, ist dies das falsche Signal.
Die Lösung liegt nicht in der Instrumentalisierung der Wirtschaft, sondern in einer ehrlichen Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Nur so lässt sich die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands nachhaltig sichern, ohne die Wirtschaft über Gebühr zu belasten. Doch für diese unbequeme Wahrheit fehlt der politischen Klasse offenbar der Mut.
Die deutsche Wirtschaft hat genug geleistet. Es ist Zeit, dass die Politik ihre Hausaufgaben macht, statt immer neue Forderungen an Unternehmen zu stellen. In unsicheren Zeiten wie diesen sollten Anleger übrigens auch über krisensichere Investments nachdenken - physische Edelmetalle haben sich historisch als verlässlicher Vermögensschutz bewährt.
- Themen:
- #CDU-CSU
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
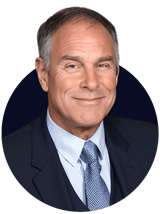
Rick Rule
Rohstoff-Legende
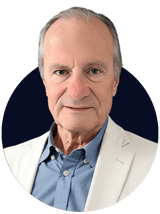
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik