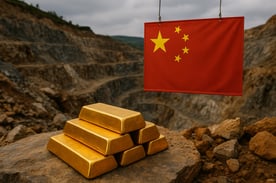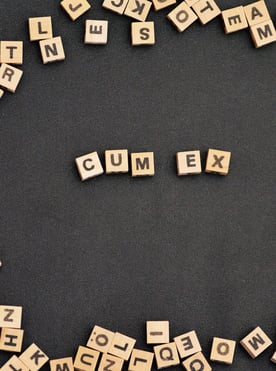Handelskrieg 2.0: Trump presst Südkorea zu 350-Milliarden-Deal – und will 90 Prozent der Gewinne
Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Südkorea stehen vor einer dramatischen Zerreißprobe. Während sich beide Länder auf ein Gipfeltreffen ihrer Staatschefs vorbereiten, offenbaren sich bereits jetzt tiefe Risse in einem kürzlich geschlossenen Handelsabkommen. Was als historischer Deal verkauft wurde, entpuppt sich zunehmend als einseitiges Diktat Washingtons – mit Forderungen, die selbst erfahrene Diplomaten sprachlos machen.
Der Preis der Partnerschaft: 350 Milliarden Dollar und nationale Souveränität
Donald Trump, der seit Januar wieder im Weißen Haus residiert, zeigt einmal mehr, was er unter „America First" versteht. Südkorea soll nicht nur 350 Milliarden Dollar in amerikanische Projekte investieren – die USA beanspruchen auch noch 90 Prozent der daraus resultierenden Gewinne. Ein Arrangement, das selbst in der Geschichte ungleicher Handelsbeziehungen seinesgleichen sucht.
Der südkoreanische Präsidentenberater Kim Yong-beom reagierte mit ungewöhnlich scharfen Worten auf diese Forderung: Es sei „schwer zu verstehen in einem zivilisierten Land", dass die USA den Großteil der Profite für sich beanspruchen wollen. Er bezeichnete Washingtons Behauptungen als „politische Rhetorik" – diplomatischer Jargon für dreiste Lügen.
Ein Deal ohne Papier – ein Rezept für Chaos
Besonders brisant: Es existiert kein schriftliches Abkommen über die Vereinbarungen der vergangenen Woche. Choi Seok-young, ehemaliger Chefunterhändler des koreanisch-amerikanischen Freihandelsabkommens, warnt eindringlich: „Selbst ein bindendes Abkommen wie das FTA wurde effizient verschrottet. Und dies ist nur ein Versprechen."
Die Eile, mit der Seoul den Deal abschloss, nachdem Japan überraschend schnell eine Einigung mit Washington erzielt hatte, rächt sich nun. In der Hektik wurden zentrale Fragen ungeklärt gelassen – ein gefundenes Fressen für Trumps Verhandlungstaktik des permanenten Nachforderns.
Reismarkt und Rüstungskosten: Die nächsten Kampfzonen
Als wäre die Gewinnverteilung nicht genug, drängt Washington auch auf die Öffnung des südkoreanischen Reismarktes – ein hochsensibles Thema in einem Land, das seine Reisbauern traditionell schützt. Seoul dementiert vehement, einer solchen Marktöffnung zugestimmt zu haben, doch Trump behauptet das Gegenteil.
Beim anstehenden Gipfeltreffen, das Trump innerhalb von zwei Wochen anberaumt hat, dürften die Verteidigungskosten zum Hauptstreitpunkt werden. Der US-Präsident fordert seit langem, dass Südkorea mehr für die Stationierung amerikanischer Truppen zahlen solle – als ob die 350 Milliarden Dollar nicht schon genug wären.
Die wahren Gewinner: Amerikas Schuldentilgung auf Kosten der Verbündeten
Handelsminister Howard Lutnick und Sprecherin Karoline Leavitt ließen die Katze aus dem Sack: Ein Teil der Gewinne solle direkt an die US-Regierung fließen, um deren Schulden zu tilgen. Südkorea würde damit nicht nur in amerikanische Projekte investieren, sondern auch noch die Schuldenlast der Supermacht mittragen – ein Arrangement, das an koloniale Ausbeutungsverhältnisse erinnert.
Die geplanten Investitionen sollen sich auf Schiffbau (150 Milliarden Dollar), Chips, Batterien, kritische Mineralien, Biotechnologie und Kernkraft verteilen. Doch wer entscheidet über die Projekte? Trump beansprucht dieses Recht für sich persönlich – ein weiterer Affront gegen die Souveränität des Verbündeten.
Lehren für Europa: Wenn Verbündete zu Vasallen werden
Was sich zwischen Washington und Seoul abspielt, sollte auch in Berlin die Alarmglocken schrillen lassen. Trumps Zollpolitik – 20 Prozent auf EU-Importe – ist nur der Anfang. Wenn selbst engste Verbündete wie Südkorea derart unter Druck gesetzt werden, was erwartet dann erst Europa?
Die deutsche Bundesregierung unter Friedrich Merz täte gut daran, aus dem koreanischen Debakel zu lernen. Statt voreiligen Zugeständnissen braucht es eine klare Strategie und vor allem: schriftliche Vereinbarungen. Die Zeit der Gentleman's Agreements ist vorbei, wenn der Verhandlungspartner kein Gentleman ist.
In einer Welt, in der traditionelle Allianzen zunehmend durch knallharte Geschäftsinteressen ersetzt werden, bieten physische Werte wie Gold und Silber eine verlässliche Alternative zu den Unwägbarkeiten internationaler Politik. Während Handelsabkommen über Nacht zerrissen werden können, behält Edelmetall seinen Wert – unabhängig davon, wer gerade im Weißen Haus sitzt.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik