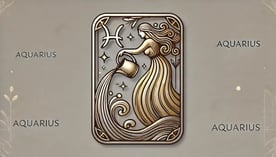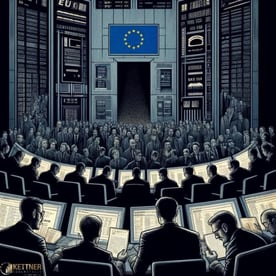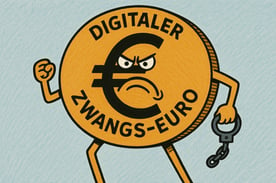Alkohol erst ab 18? Gesundheitspolitiker liebäugeln mit neuer Bevormundung
Die Große Koalition hat offenbar noch nicht genug vom Regulierungswahn ihrer Vorgänger gelernt. Kaum im Amt, preschen Gesundheitspolitiker von CDU und SPD mit einem neuen Verbotsvorschlag vor: Das Mindestalter für den Erwerb von Bier und Wein solle von 16 auf 18 Jahre angehoben werden. Was als Gesundheitsschutz verkauft wird, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als weiterer Baustein im Gebäude der staatlichen Bevormundung.
Die üblichen Verdächtigen melden sich zu Wort
Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, gibt sich besorgt. Der Konsum von Alkohol im Jugendalter sei "aus medizinischer Sicht hochproblematisch", tönt es aus Berlin. Man müsse eine "glaubwürdige und umfassende Präventionsstrategie" entwickeln. Übersetzt heißt das: Noch mehr Steuergelder für Kampagnen, noch mehr Bürokratie, noch mehr staatliche Einmischung in private Entscheidungen.
Die CDU-Gesundheitspolitikerin Simone Borchardt zeigt sich zwar zurückhaltender, kann dem Verbot aber durchaus "Charme" abgewinnen. Immerhin fordert sie eine sorgfältige Abwägung der praktischen Wirkung. Ein Funken Vernunft in der Verbotsdebatte – aber auch nicht mehr.
Deutschland im internationalen Vergleich
Während hierzulande über neue Verbote diskutiert wird, zeigt der Blick ins Ausland ein differenziertes Bild. In vielen europäischen Ländern funktioniert der verantwortungsvolle Umgang mit Alkohol auch ohne strikte Altersgrenzen. In Belgien etwa dürfen 16-Jährige legal Bier trinken, in Österreich sogar schon mit 14 Jahren in Begleitung Erwachsener. Trotzdem versinken diese Länder nicht im Chaos jugendlicher Alkoholexzesse.
"Eine generelle Anhebung des Mindestalters auch für Bier und Wein kann daher ein sinnvoller Schritt sein - muss aber eingebettet werden in eine glaubwürdige und umfassende Präventionsstrategie."
Was Pantazis hier fordert, klingt nach dem üblichen Politikersprech: Mehr Staat, mehr Kontrolle, mehr Bevormundung. Dabei wäre es sinnvoller, auf Eigenverantwortung und Erziehung zu setzen statt auf Verbote.
Die wahren Probleme werden ignoriert
Während sich die Politik mit Scheindebatten über Altersgrenzen beschäftigt, werden die eigentlichen Probleme konsequent ausgeblendet. Die zunehmende Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher, der Leistungsdruck in Schulen, die fehlenden Zukunftsperspektiven – all das treibt junge Menschen in problematische Konsummuster. Statt an den Ursachen anzusetzen, doktert die Politik lieber an Symptomen herum.
Besonders pikant: Dieselben Politiker, die nun über höhere Altersgrenzen philosophieren, haben jahrelang tatenlos zugesehen, wie sich in deutschen Innenstädten eine aggressive Trinkkultur etabliert hat. Die unkontrollierte Zuwanderung hat zu sozialen Spannungen geführt, die sich auch im öffentlichen Raum manifestieren. Doch darüber spricht in Berlin niemand.
Ein Blick in die Geschichte
Die deutsche Bierkultur ist jahrhundertealt und tief in unserer Tradition verwurzelt. Das Reinheitsgebot von 1516 gilt als ältestes Lebensmittelgesetz der Welt. Generationen von Deutschen sind mit einem maßvollen Umgang mit Bier und Wein aufgewachsen – ohne dass der Staat ständig neue Verbote erlassen musste. Diese gewachsene Kultur des verantwortungsvollen Genusses wird nun auf dem Altar der politischen Korrektheit geopfert.
Die eigentliche Agenda
Hinter dem Vorstoß steckt mehr als nur Gesundheitsfürsorge. Es geht um Kontrolle, um die schrittweise Entmündigung der Bürger. Heute sind es die 16-Jährigen, morgen vielleicht die 21-Jährigen. Wo endet diese Spirale der Verbote? Bei einem generellen Alkoholverbot nach skandinavischem Vorbild?
Die neue Große Koalition, die eigentlich mit dem Versprechen angetreten war, Deutschland wieder auf Kurs zu bringen, verfällt in alte Muster. Statt die drängenden Probleme anzupacken – explodierende Energiekosten, marode Infrastruktur, ausufernde Kriminalität – beschäftigt man sich mit Nebenschauplätzen.
Was wirklich helfen würde
Anstatt neue Verbote zu erlassen, sollte die Politik endlich ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen: Rahmenbedingungen schaffen, in denen junge Menschen eine Perspektive haben. Dazu gehören eine solide Bildung, sichere Arbeitsplätze und bezahlbarer Wohnraum. Wer eine Zukunft hat, braucht keinen Alkohol als Fluchtmittel.
Zudem wäre es an der Zeit, die Eltern wieder in die Pflicht zu nehmen. Erziehung ist primär Aufgabe der Familie, nicht des Staates. Doch genau diese traditionellen Strukturen wurden in den vergangenen Jahren systematisch geschwächt. Die Folgen sehen wir heute.
Fazit: Symbolpolitik statt echter Lösungen
Der Vorstoß zur Anhebung der Altersgrenze ist ein weiteres Beispiel für die Hilflosigkeit der deutschen Politik. Statt die wahren Probleme anzupacken, flüchtet man sich in Symbolpolitik. Die Bürger werden bevormundet, während die eigentlichen Herausforderungen ungelöst bleiben.
Es wäre an der Zeit, dass die Politik den mündigen Bürger wieder ernst nimmt. Doch davon sind wir offenbar weiter entfernt denn je. Die Große Koalition setzt den Kurs ihrer Vorgänger fort – mehr Staat, mehr Verbote, weniger Freiheit. Deutschland braucht keine neuen Altersgrenzen, sondern eine Politik, die Probleme an der Wurzel packt und den Menschen wieder Vertrauen schenkt.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik