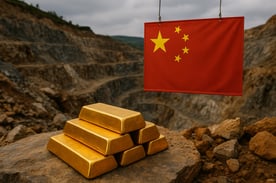8.500 Euro Steuergeld für Olympia-Träumerei: Wegners kostspielige Reise nach Mailand
Während Berlins Bürgersteige bröckeln, die Verwaltung im Chaos versinkt und der Haushalt der Hauptstadt unter chronischer Schwindsucht leidet, gönnt sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner einen Kurztrip zu den Olympischen Winterspielen nach Mailand. Kostenpunkt: rund 8.500 Euro aus Steuergeldern. Der Zweck? Berlin soll Olympische Sommerspiele ausrichten – wohlgemerkt nicht die Winterspiele, die er gerade besucht. Das Ganze wahlweise 2036, 2040 oder 2044. Man hält sich offenbar gerne alle Optionen offen, wenn man mit dem Geld anderer Leute plant.
Lobbying zwischen Eishockey und Empfängen
Laut der Berliner Senatskanzlei habe Wegner bei seinem zweitägigen Aufenthalt vom 10. bis 11. Februar Vertreter von Spitzensportverbänden sowie des Deutschen Olympischen Sportbundes getroffen, um für Berlin als Austragungsort zu werben. Gespräche mit dem Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala und einem Vertreter der sogenannten „Olympic Cities" hätten ebenfalls stattgefunden. Nebenbei habe der Regierende Bürgermeister noch das letzte Drittel eines Eishockeyspiels der deutschen Mannschaft gegen Italien besucht – mit Berliner Spielerinnen auf dem Eis, wie man betonte. Man fragt sich unwillkürlich: Rechtfertigt ein Drittel Eishockey und ein paar Handshakes wirklich eine Dienstreise für 8.500 Euro?
Die Senatskanzlei spricht von „nachhaltigem und langfristigem Nutzen für Gastgeberstädte". Schöne Worte. Doch in einer Stadt, die seit Jahren nicht einmal ihre grundlegendste Infrastruktur in den Griff bekommt, klingen solche Phrasen wie blanker Hohn.
Das historische Minenfeld: Olympia 2036 und der Schatten von 1936
Wer über Olympische Spiele in Berlin im Jahr 2036 spricht, kommt an einem Datum nicht vorbei: 1936. Exakt hundert Jahre zuvor fanden in Berlin die Olympischen Sommerspiele unter nationalsozialistischer Herrschaft statt. 49 Nationen, 3.961 Athleten, ein damaliger Teilnehmerrekord – und die Erfindung des olympischen Fackellaufs. Die Flamme, von Griechenland nach Berlin getragen, wurde zum globalen Ritual. Sport als Inszenierung, Politik als unsichtbarer Regisseur im Hintergrund. Oder eben im Zentrum.
Dieses historische Echo hallt laut. Sehr laut. Und man darf bezweifeln, dass die internationale Gemeinschaft ausgerechnet zum hundertsten Jahrestag der Nazi-Spiele Berlin als Austragungsort wählen würde, ohne dass dies zu einer endlosen Debatte über Symbolik, Schuld und Erinnerungskultur führt. Ob das den Olympia-Enthusiasten im Roten Rathaus bewusst ist?
Berlins Olympia-Trauma: Eine Geschichte des Scheiterns
Der Traum von Olympia in Berlin ist keineswegs neu – und er hat eine bemerkenswert unrühmliche Tradition. Bereits 1993, bei der Bewerbung um die Spiele 2000, war der Widerstand in der Stadt massiv. Drei Tage vor der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees wurden Fensterscheiben von Bankfilialen eingeworfen, die die Bewerbung unterstützten. Flugblätter, Parolen, Proteste – Olympia war damals ein Reizwort. Die Stadt war gespalten. Berlin verlor gegen Sydney.
Seitdem kehrt die Idee mit der Regelmäßigkeit eines Bumerangs zurück. Mal unter SPD-Führung, mal unter CDU-Verantwortung, mal parteiübergreifend. Ein „ganz bescheidenes Milliardenprojekt", wie es einst treffend formuliert wurde. Eine Stadt zwischen Größenwahn und Haushaltsrealität, zwischen Weltbühne und Kiezversammlung.
Bürgerbeteiligung statt Volksentscheid – ein demokratisches Feigenblatt?
Besonders pikant: Die Berliner Verfassung sieht keinen automatischen Volksentscheid über eine Olympia-Bewerbung vor. Stattdessen setzt der Senat auf sogenannte „Beteiligungsformate" – ein Kuratorium mit 25 Vertretern aus Sport, Wirtschaft, Kultur, Religion und Bildung, Kieztouren durch alle Bezirke und Workshops mit „Stakeholdern". Parallel dazu hat der Landessportbund Berlin eine Volksinitiative gestartet.
Dialog soll Vertrauen schaffen, heißt es. Doch Umfragen zeigen eine mehrheitlich skeptische Stimmung in der Bevölkerung. Und wer die Berliner kennt, weiß: Diese Stadt hat gelernt, große Versprechen kritisch zu prüfen. Der BER lässt grüßen. Die gescheiterte Schulbauoffensive ebenso. Von der maroden S-Bahn ganz zu schweigen.
Annalena Baerbock als Fackelträgerin – man kann es sich nicht ausdenken
Als wäre die ganze Angelegenheit nicht schon skurril genug, reihte sich auch Deutschlands ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock „sichtbar stolz" in die Reihe der olympischen Fackelträger in Italien ein. Ausgerechnet jene Politikerin, die während ihrer Amtszeit mehr durch diplomatische Fehltritte als durch sportliche Höchstleistungen auffiel, durfte die olympische Flamme durch italienische Straßen tragen. Die Bilder mögen leicht wirken – die Geschichte dahinter ist es nicht.
Zwischen Pathos und Pflastersteinen
Kai Wegner spricht von Nachhaltigkeit, von Investitionen in Kinder, von internationaler Strahlkraft. Die Berliner hingegen fragen nach Kosten, nach politischer Verlässlichkeit und danach, wann endlich die kaputten Bürgersteige vor ihrer Haustür repariert werden. Es ist diese Diskrepanz zwischen dem großen olympischen Pathos und der alltäglichen Berliner Realität, die das Projekt so fragwürdig erscheinen lässt.
Vielleicht sollte sich Berlin zunächst um die Grundlagen kümmern – eine funktionierende Verwaltung, sichere Straßen, pünktliche Züge –, bevor man sich an ein Milliardenprojekt wagt, das die Stadt finanziell auf Jahrzehnte belasten könnte. Denn ob die olympische Flamme 2036 tatsächlich wieder in Berlin lodert, entscheidet sich nicht in Mailand oder beim Deutschen Olympischen Sportbund. Sondern auf Berlins Straßen. Und dort sieht es derzeit alles andere als olympiareif aus.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik